von Anja Cantzler | 23.09.2025 | Kinderschutz, Kindheit ist politisch
Manchmal frage ich mich: Für wen wird in diesem Land eigentlich Politik gemacht? Für die Kinder sicher nicht. Nicht, wenn man sich ansieht, wie derzeit in Nordrhein-Westfalen an der KiBiz-Reform gebastelt wird – hinter verschlossenen Türen, ohne dass Eltern, Fachkräfte oder Expert:innen wirklich einbezogen werden.
Kitas am Limit – Kinder vor verschlossenen Türen
Fachkräfte arbeiten am Limit, kämpfen gegen Personalmangel, überfüllte Gruppen und eine Unterfinanzierung, die ihnen die Luft abschnürt. Und in anderen Orten genau das Geenteil- hier gibt es auf einmal zu wenige Kinder. Plätze bleiben frei. es drohen Gruppenschließungen und Entlassungen. Misswirtschaft auf ganzer Linie.
Statt bei letzteren den Personalschlüssel zu erhöhen oder die Gruppen zu verkleinern, werden ganze Gruppen oder sogar komplette Kitas geschlossen. Gleichzeitig wird der Kindertagespflege vielerorts die Grundlage entzogen – jene flexible Form der Betreuung, die oft genau dort einspringt, wo Kitas überlastet sind oder fehlen.
Kinder – eine schutzlose Minderheit
Kinder sind die schwächste, aber wichtigste Minderheit unserer Gesellschaft. Sie haben keine Lobby. Sie können ihre Stimme noch nicht erheben, sie können nicht protestieren. Und genau deshalb müssen wir Erwachsenen dafür sorgen, dass ihre Rechte geschützt werden.
Aladin El-Mafaalani beschreibt in seinem Buch „Kinder – Minderheit ohne Schutz“, wie Kinder in einer alternden Gesellschaft immer weniger gesehen werden und politische Entscheidungen von den Interessen der Erwachsenen geprägt werden. Er fordert einen Minderheitenschutz für Kinder – und damit eine Politik, die sie ernst nimmt.
Bundespolitik: Ansprüche der Familien runterfahren?
Parallel zu den Herausforderungen in NRW fordert die Bundesministerin Prien, die Ansprüche der Familien an die Kinderbetreuung zu reduzieren. Es geht nicht um Qualität sondern um Quantität. Betreuung und Bildung werden nicht gestärkt, sondern beschnitten. Fachkräfte sehen sich weiter überlastet, während Eltern auf Unterstützung verzichten sollen. Und auf wessen Rücken wird das ausgetragen? Auf dem der Kinder. Kinder verlieren so immer weiter wertvolle Chancen für frühkindliche Förderung.
Aufwachsen in Würde ist ein Recht
Kinder haben ein Recht auf Bildung, auf Förderung und auf eine Betreuung, die ihre Entwicklung unterstützt. Familien haben ein Recht auf auf verlässliche Strukturen und Entlastung. Fachkräfte haben ein Recht auf Wertschätzung, faire Bezahlung und menschenwürdige Arbeitsbedingungen.
Wenn wir weiterhin die Qualität der Betreuung beschneiden, Gruppen vergrößern, Kitas schließen und die Kindertagespflege aushöhlen, dann ist das ein System, das Kinder und Familien im Stich lässt.
Jetzt aktiv werden
Wir dürfen nicht schweigen. Jede:r von uns kann etwas tun:
- Engagiert euch in den Fachkräfteverbänden der einzelnen Länder, unterstützt den Austausch, bringt eure Expertise ein.
- Schreibt offene Briefe an Politiker:innen, fordert Transparenz, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Investitionen in die Bildung unserer Kinder.
- Beteiligt euch an offenen Anhörungen und geht zu Ausschusssitzungen auf kommunaler Ebene.
- Teilt eure Erfahrungen und Geschichten, macht deutlich: Die Politik darf Kinder, Eltern und Fachkräfte nicht länger ignorieren.
Aufwachsen in Würde darf kein Privileg sein. Es ist ein Recht – ein Recht, das wir verteidigen müssen, bevor es zu spät ist.
Eure Anja
Quellen:
El-Mafaalani, Aladin: Kinder – Minderheit ohne Schutz. Kiepenheuer & Witsch, 2025.
Jugendhilfeportal NRW – KiBiz-Reform
Ministerium für Schule und Bildung NRW – KiBiz
von Anja Cantzler | 25.06.2025 | Allgemein, Kindheit ist politisch
Der Dunning-Kruger-Effekt und seine Bedeutung im Umgang mit pädagogischem Populismus
In bildungspolitischen Debatten, auf Elternabenden oder in sozialen Netzwerken tauchen sie immer wieder auf: einfache Lösungen für komplexe pädagogische Fragen. Sätze wie „Früher hat das doch auch funktioniert“, „Kinder brauchen nur klare Regeln und Grenzen“ oder „Inklusion kann doch gar nicht klappen“ prägen viele Diskussionen. Was auf den ersten Blick wie gesunder Menschenverstand klingt, entpuppt sich oft als Ausdruck eines größeren Problems: pädagogischer Populismus. Und dieser wiederum lässt sich durch ein bekanntes psychologisches Phänomen besser verstehen – den Dunning-Kruger-Effekt.
Was ist der Dunning-Kruger-Effekt?
Der Dunning-Kruger-Effekt beschreibt eine Verzerrung der Wahrnehmung, bei der Menschen mit weniger Kompetenz oder begrenzterem Wissen dazu neigen, ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten zu überschätzen. Gleichzeitig neigen Personen mit einem umfangreicheren Expert:innenwissen dazu, ihre Kenntnisse eher zu unterschätzen. Das rührt oftmals daher, dass diese Personen sich der Komplexität eines Themas bewusst sind. Sie wissen, dass sie nicht alles wissen können.
Dieses Missverhältnis zwischen tatsächlicher und wahrgenommener Kompetenz lässt sich in vier Phasen beschreiben:
Die vier Phasen des Dunning-Kruger-Effekts:
- Gipfel der Selbstüberschätzung („Mount Stupid“):
Die Person zeichnet sich durch wenig Wissen und viel Selbstbewusstsein aus. Sie glaubt, die Lösung bereits zu kennen – und äußert sich entsprechend lautstark und überzeugt.
- Tal der Verzweiflung:
In dieser Phase tauchen zunehmend Zweifel tauchen auf, weil Widersprüche oder komplexe Zusammenhänge erkennbar werden. Das Selbstvertrauen bezüglich des tatsächlichen Wissens sinkt rapide.
- Pfad der Erleuchtung:
Mit wachsendem Wissen wächst auch die Demut. Die Person erkennt, dass es nicht nur den einen Weg bzw. die eine Lösung gibt.
- Plateau der Nachhaltigkeit/ Kompetenz:
Die Person hat sich eine echte und umfassende Expertise angeeignet. Sie ist geprägt von einem realistischen Selbstbild, der gründlichen Differenzierungsfähigkeit und fachlicher Tiefe.
Pädagogischer Populismus trifft Dunning-Kruger
In vielen Bildungsdebatten zeigt sich dieser Dunning-Kruger-Effekt zunehmend und wird aus den unterschiedlichsten Richtungen gespeist und bedient: Im pädagogischen Alltag zeigt sich dies bei Menschen mit wenig pädagogischem Fachwissen oder ohne Einblick in aktuelle wissenschaftliche Diskurse, die trotzdem besonders überzeugt auftreten und auf ihren Standpunkten beharren. Dies geschieht oftmals, weil ihnen die Tiefe und Vielschichtigkeit der pädagogischer Prozesse schlichtweg nicht bekannt bzw. nicht bewusst ist.
Beispiele:
- Ein Elternteil findet es völlig in Ordnung, mit einem Kind auch mal laut zu schimpfen, weil „das ihm selbst ja auch nicht geschadet hat.“.
- Politiker*innen fordern „mehr Grenzen und Regeln, weniger Kuschelpädagogik“, ohne empirische Belege.
- Medien greifen einzelne Extremfälle auf und stilisieren sie zu allgemeinen Wahrheiten.
In all diesen Fällen wird pädagogische Komplexität durch vermeintlich klare, einfache Aussagen ersetzt – oft verbunden mit Emotionen, Moral und nostalgischen Rückblicken.
Und warum fällt es Fachkräften schwer, dagegenzuhalten?
Es ist oftmals so schwer etwas dagegegn zu halten, weil gute Pädagogik selten einfache Antworten hat.
Wer sich mit Bildung, Lernen, Entwicklung, Differenzierung und Inklusion beschäftigt, weiß, dass pädagogische Entscheidungen fast immer Kontexte, Perspektiven und Widersprüche berücksichtigen müssen. Diese vorsichtige, differenzierte Haltung wirkt im öffentlichen Diskurs jedoch oft zögerlich und unklar – und wird leicht übertönt.
Als Fachkraft sagen wir dann Dinge wie:
- „Das kommt auf den Einzelfall an.“
- „Dazu gibt es keine eindeutige Antwort.“
- „Wir müssen verschiedene Perspektiven betrachten.“
Solche Sätze sind fachlich korrekt – aber in einer lauten Debattenkultur schwer zu vermitteln.
Was hilft gegen pädagogischen Populismus?
- Bildung und Aufklärung:
Mut, die eigene Fachlichkeit öffentlich sichtbarer und hörbarer zu machen. Es geht darum, die evidenzbasierten Argumente möglichst verständlich und nachvollziehbar zu kommunizieren, ohne überheblich zu wirken.
- Medienkompetenz stärken:
Es gilt Meinung von Fachwissen zu unterscheiden und gerade in komplexen Fachfragen nachfragen, wenn das Gegenüber es sich allzu einfach macht.
- Mut zur Differenzierung:
Auch in schwierigen Diskussionen gilt es Haltung zeigen. Die Kunst besteht darin zuzuhören, Gemeinsamkeiten herauszustellen – ohne sich auf populistische Vereinfachungen einzulassen.
- Empathie mitdenken:
Der Dunning-Kruger-Effekt ist kein Beweis für Dummheit, sondern ein Hinweis auf unbewusste Kompetenzlücken. Diese lassen sich ansprechen – respektvoll, aber bestimmt.
Fazit:
Pädagogischer Populismus lebt von einfachen Antworten auf schwierige Fragen. Der Dunning-Kruger-Effekt hilft, diese Dynamiken besser zu verstehen – und zeigt: Lautstärke ersetzt keine Kompetenz.
Gerade im Bildungsbereich brauchen wir mehr Raum für fachlichen Tiefgang, weniger für Stammtischrhetorik. Denn wer wirklich etwas von Pädagogik versteht, weiß: Bildung ist selten einfach – und immer wichtig!
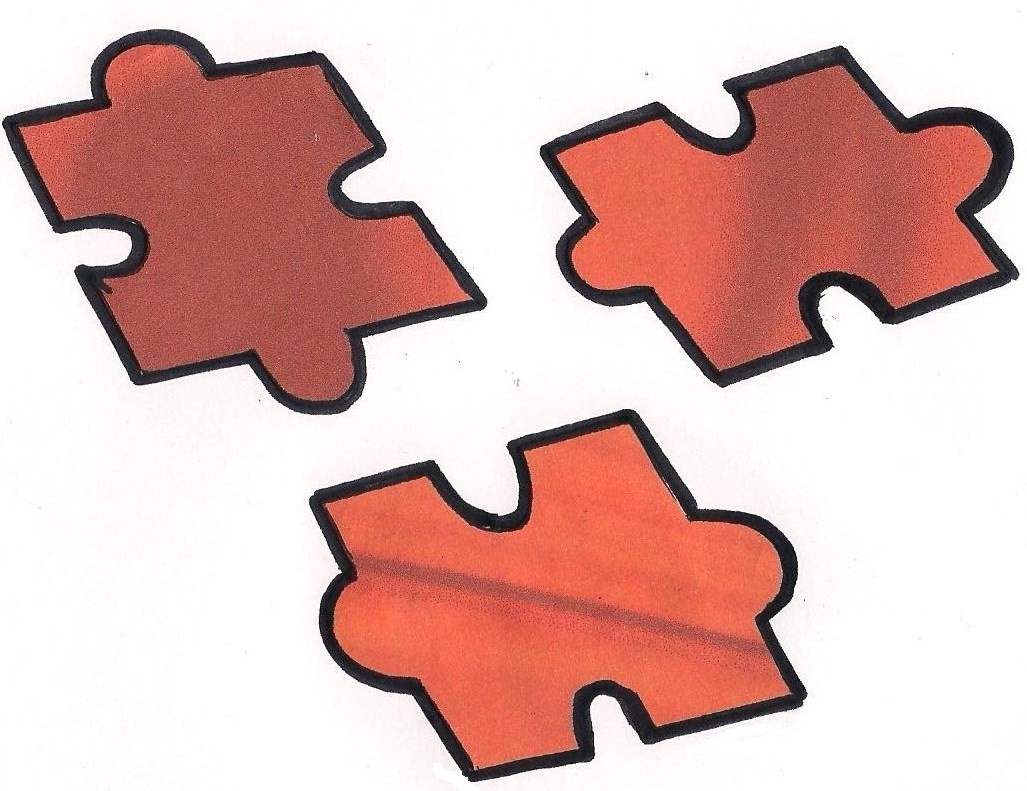
Neueste Kommentare