von Anja Cantzler | 1.08.2023 | Bindung und Eingewöhnung, Peergroup Eingewöhnung, Übergänge
Hier in NRW enden diese Woche die Schulferien und die ersten Eingewöhnungen sind bereits im vollen Gange.
Aufnahme und Eingewöhnung von neuen Kindern und ihren Familien sind immer wiederkehrende Themen in Krippe, Kita und Kindertagespflege. Die Eingewöhnung ist die Basis für alles weitere: zum einen mit Blick auf die Entwicklung des Kindes und zum anderen mit Blick auf die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Eine Eingewöhnung ist in der Regel nicht nach zwei bis drei Wochen abgeschlossen, je nach Kind dauert sie auch gerne länger. Meines Erachtens ist dabei wichtig nicht an einem Modell starr zu kleben, sondern diesen Übergang möglichst individuell und bedürfnisorientiert zu gestalten und zu begleiten.
Bereits 2021 habe ich einen ähnlichen Blogartikel veröffentlicht, den ich hiermit aktualisieren und ergänzen möchte, da seither viele neue Beiträge, Materialien und Bücher von meinen Kolleg*innen und mir erschienen sind.
Vorab möchte ich dir meine 5 Tipps zur Eingewöhnung ans Herz legen. Hierbei handelt es sich um einen mehrteiligen E-Mail Kurs, mit dessen Hilfe du über eine Woche hinweg eure Eingewöhnung reflektieren und überprüfen kannst. Vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Anregungen, um im kommenden Jahr, die Gestaltung des Übergangs zu verändern.
Eingewöhnung, Ankommenszeit, Beziehungszeit…
Zunächst einmal ein paar kurze Gedanken zum Begriff „Eingewöhnung“. Ich bin schon seit einigen Jahren nicht mehr glücklich mit dem Begriff „Eingewöhnung“. Er hat zum einen etwas sehr passives: „die Kinder und ihre Familien“ werden eingewöhnt. Dabei sollten sie doch zu jedem Zeitpunkt aktiv am Prozess beteiligt sein. Sie bestimmen Tempo und Vorgehen je nach Bedürfnis mit. Zum anderen sollte es nicht darum gehen, dass sich irgendwer an irgendetwas „gewöhnen“ muss. Geht es nicht in erster Linie um den Beziehungsaufbau? Nicht Gewöhnung sondern sich miteinander vertraut machen und zueinander Vertrauen aufbauen, darum sollte es gehen. Im besten Fall gelingen Übergang und Beziehungsaufbau so, dass die Kinder gerne und mit Freude zu dir in die Krippe, Kita und Kindertagespflege kommen.
Deswegen würde ich mich gerne langfristig von dem Begriff der Eingewöhnung verabschieden. Ankommens- und Kennenlernzeit sind für mich viel stimmigere Begrifflichkeiten.
Meine Motivation
Warum ist mir das Thema so wichtig? Meine Erfahrungswissen reicht nun gut 30 Jahre zurück und als junge Fachkraft im Berufspraktikum habe ich noch miterlebt, was es hieß keinen gut begleiteten Übergang für Kinder und ihre Familien zu gestalten.
Mein erster Arbeitstag war die Hölle. Die mir fremden Kinder wurden gebracht und mussten umgehend bis zu 4 Stunden ohne Eltern in meiner Gruppe bleiben. Uns ging es allen unglaublich schlecht damit: viele Kinder haben gelitten- leise oder laut, je nach Persönlichkeit und Vorerfahrung. Die Eltern mussten gehen und waren buchstäblich unerwünscht- bloss nicht zu lange bleiben, das Kind könnte sich ja daran gewöhnen. Und ich war mega gestresst und abends fix und fertig.
Ich spürte sehr früh, dass da etwas gehörig falsch lief.
In den drei Folgejahren baute ich nach und nach 3 neue Kitas mit auf – erst als Fachkraft, später als Leitung. Die jüngsten Kinder waren 4-6 Monate alt. Uns war schnell klar, dass da die Eltern mit ins Boot geholt werden müssen, damit die Kinder sanft und sicher bei uns ankommen können.
Wir machten gute Erfahrungen und gut 12 Jahre nach meinem Berufseinstieg war mir als Weiterbildnerin klar, was ich für Kinder im Übergang von der Familie in die Kita möchte. Ich lernte das Berliner Eingewöhnungsmodell kennen und kämpfte gegen viele Windmühlen, um eine elternbegleitete und bezugspersonenorientierte Eingewöhnung als Standard für Kitas mit einzuführen.
Seither begleitet mich dieses Thema und lässt mich nicht mehr los. Auch wenn ich seit einigen Jahren mich intensiver mit der PeergroupEingewöhnung beschäftigt habe und darüber referiere- mein Herz hängt seit eh und je an einer an den Bedürfnissen des Kindes und seiner Familie orientierten Ankommenszeit. Aus meiner Sicht ist jede Familie individuell zu betrachten und zu begleiten.
Gesammelte Blogartikel
Auf diesem Wissen- und Erfahrungshintergrund sind in den letzten drei Jahren hier viele Blogartikel für die Begleitung der Kinder und Familien von zu Hause in die Kita entstanden. Zur besseren Übersicht findest du hier eine Aufstellung der verschiedenen Beiträge (mit einem einfachen Klick auf den Link gelangst du zu den einzelnen Artikeln) :
Bücher, Blogartikel und mehr speziell zur Peergroup-Eingewöhnung
Bereits im November 2023 ist mein Buch zur Peergroup Eingewöhnung im Verlag an der Ruhr erschienen. Das Buch erläutert die theoretischen Grundgedanken und stellt dar, welche Bedeutung die Gruppe der Gleichaltrigen für die kindliche Entwicklung hat. Mein Fokus lliegt dabei auf der praktischen Umsetzung des Modells. Hier kommst du direkt zur Bestellung.
Um dich schon einmal ins Thema einzuschwingen, habe ich dir hier ein paar Blogartikel zusammengestellt:
Mittlerweile war ich schon in einigen Podcasts zu dem Thema als Expertin eingeladen:
Bei meinen KitaTalks begegnet dir die Peergroup auch gleich zweimal:
Wenn du ergänzend zu diesen Infos an einem Seminar zu diesem Thema interessiert bist, gibt es im Herbst 2023 und im Frühjahr 2024 wieder verschiedene Live-Online Seminare im Haus Neuland, Kath. Landvolkshochschule Hardehausen und VHS Hannover Land. Auf Anfrage biete ich auch Online Seminare für Teams an.
Meine KitaTalks
Es gibt auch noch einige Folgen der Kita Talks zum Thema Eingewöhnung, wo es um die bedürfnisorientierte Eingewöhnung, die Eingewöhnung von Kindern mit und ohne Fluchterfahrung und der kultursensiblen Eingewöhnung geht. Zum Stöbern in den KitaTalks klickst du am besten HIER.
Beliebte andere Podcasts
Weitere Bücher und Materialien
Gerade ganz neu erschienen ist das sehr empfehlenswerte Buch von Lea Wedewardt: Ankommen dürfen statt Loslassen müssen. Hier wird aus vielen Blickwinkeln beschrieben, wie eine Bedürfnisorientierte Eingewöhnung in der Praxis gelingen kann. Hier erfährst du mehr und kommst direkt zur Bestellung.
Eine weitere sehr empfehlenswerte Neuerscheinung ist das Praxisbuch zur Eingewöhnung vom Krüger&Thiel Institut. Das Buch bietet eine Fülle von Ideen und Anregungen für Eltern und Fachkräfte. Es gibt Orientierung, wie die Eingewöhnungsphase gestaltet werden kann, damit Kinder, Eltern und Fachkräfte einen gelingenden, gemeinsamen Start in die Kitazeit bekommen können.
Das Krüger & Thiel Institut hat außerdem eine kleine Broschüre mit dem Titel: Sanfte Eingewöhnung für mein Kind veröffentlicht. Die Broschüre bestehen aus liebevoll zusammengestellten Fotos mit Szenen aus dem Eingewöhnungsalltag einer KiTa. Hier wird den Kindern eine Stimme gegeben und somit ihre Sichtweise auf die Eingewöhnung verdeutlicht. Die Erwachsenen bekommen Handlungsanregungen für die Gestaltung und Begleitung des Eingewöhnungsprozesses. Sehr hilfreich und empfehlenswert für die Zusammenarbeit mit Eltern.
Für Kinder in der Eingewöhnung ist beim Krüger&Thiel Institut außerdem ein ganz reizendes kleines Bilderbuch: Mira, Tuffi und die Gefühle erhältlich. Hier begleitet der kleine Stoffelefant Tuffi die kleine Mira in ihrern ersten Kindergartentagen und beschreibt ihre Gefühle. Sehr schön, für die Gruppe oder als kleines Willkommensgeschenk für die neuen Kinder.
Meine geschätze Kollegin Gundula Göbel hat die Broschüre zu ihrem Bindungsbaumkonzept vor Kurzem überarbeitet. Besonders empfehlenswert für die umfassende Auseinandersetzung mit der Gestaltung einer bindungsorientierten Eingewöhnung ist ihre Schulungsbox: Bonding-Bindung-Bildung. Die schön gestaltete A4 Box ist gefüllt mit Bindungswissen. Auf 19 A4 Bildkarten ist jeweils ein Begriff des Bindungsbaumes beschrieben und mit jeweils drei konkreten Fragen zur Vertiefung versehen, auf der anderen Seite der Bildkarte ist ein sprechendes Foto mit passendem Zitat, um einen Impuls für einen Austausch im Team oder mit Eltern zu geben.
Und zu jeder guten Eingewöhnung gehört natürlich auch die Portfolioarbeit. In diesem Rahmen hat Sandra Warsewicz von der Werkstatt der Guten Gedanken sehr schöne Vorlagen entwickelt. s lohnt sich da mal durch ihre Seite zu stöbern.
Da sollte doch was für Jede*n dabei sein. Und selbstverständlich kannst du gerne in Kommentaren weitere Tipps geben, mit welchen Materialien du so in der Praxis arbeitest, um dich mit deinem Team vorzubereiten, Eltern mit ins Boot zu holen und Kinder z.B. durch Bilderbücher den Start zu erleichtern.
Ich wünsche einen guten Start ins Kita Jahr 23/24
Deine Anja
von Anja Cantzler | 19.07.2022 | Bindung und Eingewöhnung, Gastbeitrag, Peergroup Eingewöhnung
Ein besonderes Dankeschön geht hier an die Kolleginnen des Evangelischen Kindergarten Huckepack in Hüllhorst. Petra Stallmann hat sich vo ein paar Jahren auf meine Anregung hin auf den Weg gemacht, die Peergroup Eingewöhnung in ihrer Gruppe umzusetzen.
Hier kannst du nun nachlesen, wie die verschiedenen Beteiligten diese Form der Eingewöhnung erleben.
Die Eingewöhnung aus Sicht der Leitung
Die Rückmeldung der Eltern zu diesem Eingewohnungsmodell sind durchweg positiv. Das ergab sich aus dem zurückliegenden Audit. Wichtig ist es aber, die Eltern sorgfäItig über dieses Eingewöhnungsmodell zu informieren. Auch die Kontakte unter den Eltern werden intensiviert, weil Sie sich mehr als Gruppe erleben. Das stärkt ihr „Wir-GefühI“. Die EItem. erfahren auch so etwas wie eine „Eingewöhnung & Abnabelung“ als Gruppe.
Es eignet sich nur fur kleine Gruppen, weil die Räume und Personalkapazität dies sonst nicht zulassen. In einer Betreuungsgruppe in der sich 20 oder mehr Kinder befinden, gibt es bei uns keine Möglichkeit parallel zum Betreuungsalltag einen Gruppenraum „nur“ fur die Eingewöhnung vorzuhalten. Da auch nachmittags Kinder in der Einrichtung sind, steht bei uns kein Zeitfenster zur Verfügung in dem das möglich wäre. Die Personaldecke lässt kaum zusätzliche Arbeitszeiten zu, ohne dass Personal im pädagogischen Alltag fehlt. Ideal ist es, wenn Eingewöhnungszeiten ab 14 / 15 Uhr sind. So i‹ann der „normale‘ Betrieb weiterIaufen. Das bedeutet aber, dass uriter den Bestandskindern möglichst keine oder nur vereinzelt 45 Stunden gebucht sind. Im Gruppentyp II at es sich bewährt 50% der Gruppe neu zu belegen.
Die Kinder in der Krippengruppe profitieren von dieser Eingewohnung, weiI sie nicht ganz so sehr in Abhängigkeit von der einzelnen Erzieherin stehen. Natürlich ist das Personal nach wie vor ein wichtiger Bez!ehungsanker, dennoch scheinen die Kinder schneller Kontakte zu den anderen Kindern aufzubauen, was auch bedeutet, dass sie schneller ins Spiel kommen.
Die Sicht von Petra, der Gruppenleitung
Seit 2017 gewöhnen wir die Kinder unserer U3 Gruppe nach dem Peergroupmodell ein. Nach wie vor verläuft die Eingewöhnung sehr strukturiert, unkompliziert und schnell ab.
Dass die Kinder „sicher“ eingewöhnt sind, zeigt sich auch nach längeren Fehlzeiten der Kinder oder Erzieherinnen. Dieses ließ sich in den Coronazeiten gut beobachten. In der Bringzeit betreten die Kinder selbstverständlich den Raum und werden fröhlich vom Rest der Gruppe empfangen, bewegen sich zielgerichtet auf ein bestimmtes Spielzeug zu oder gehen in ihre Lieblingsecke, in der sie sich besonders wohlfühlen. Manche Kinder suchen sich anfangs eine Bezugserzieherin aus, verhalten sich aber nach kurzer Zeit sehr offen gegenüber den anderen Erzieherinnen der Gruppe.
Zum reibungslosen Ablauf der Eingewöhnung gehören die Planung, die Informationen, die Absprachen mit dem Team und den Eltern sowie die Vorbereitung der Räumlichkeiten mit Spielzeug in doppelter Ausführung. Lezteres sorgt dafür, dass die Kinder durch Beobachtung und Nachahmung auf Augenhöhe kommunizeren können und so in Interaktion treten.
Schnell bekommen die Kinder Freude am Explorieren. Die Sicherheit bietet ihnen die integrierte Elternecke, wo die Kinder jederzeit Kontakt zu ihren Eltern aufnehmen können. Darüber hinaus dient diese Ecke auch dem Kennenlernen der Eltern untereinander, was sich für die weitere Mitarbeit in der Gruppe als sehr hilfreich erwiesen hat.
Die einzugewöhnenden Kinder werden in Absprache mit den Eltern in zwei Gruppen geteilt, einer Vor- und einer Nachmittagsgruppe. Diese beiden Gruppen wurden in den letzten Jahren am vierten Tag zusammengeführt. Ganz individuell halten sich die Eltern an den folgenden Tagen in der Gruppeneltenecke, der ausgelagerten Elternecke auf oder sind per Handy jederzeit errreichbar. Meistens bestätigt sich hier, wie unkompliziert und schnell diese Form der Eingewöhnung abläuft.
Im letzen Jahr hatte ein Kind bereits zwei Tage mit der Mutter den Kindergarten besucht, sich auch sichtlich wohlgefühlt und ist dann für anderthalb Wochen erkrankt. Nach dieser Krankheitsphase begann die Eingewöhnung für dieses Kind erneut. Hier hat es sich als hilfreich erwiesen, die Gruppe zu entzerren, um dem Kind die Möglichkeit zu bieten mit zwei weiteren Kindern in Ruhe in Beziehung zu treten.
Die Sicht von Estelle, einer Gruppenkollegin
Ich empfinde das Eingewöhnungsmodell als eine sehr strukturierte und angenehme Weise, die Kinder nach ihrem eigenen Tempo in den Kindergartenalltag einzugewöhnen.
Zudem finde ich es toll, dass nicht nur die Kinder eine Beziehung und Bindung zueinander aufbauen, sondern auch die Eltern die Möglichkeit haben, sich kennenzulernen und auszutauschen, was einer tollen Atmosphäre der Gruppe und auch der Elterngemeinschaft zu Gute kommt.
Ich finde, die Kinder sind meistens sehr entspannt, und freuen sich auf die anderen Kinder, auf ein bestimmtes Spielzeug oder auf eine bestimmte Räumlichkeit, in der sie sich ganz besonders wohl gefühlt haben.
Kinder, die im selben Alter sind, können toll voneinander lernen, sich bestimmte Dinge abgucken und eine besonders feste Bindung zueinander aucfbauen, was ihnen bei der Trennung von den Eltern enorm hilft.
Vorraussetzung dafür, dass das Modell umzusetzen ist, ist die Mitarbeit der Eltern.
Ich würde abschließend sagen, dass ich in den 3 Jahren durchweg Positives in der Eingewöhnung erlebt habe und sich diese Art des Modells in unserer Gruppe bewährt hat. Außerdem finde ich es super, dass sich die Kinder selber eine Bezugsperson aussuchen können und sie nicht zugeteilt werden.
Die Sicht von Verena, einer weiteren Gruppenkollegin
Eingewöhnung in der Peergroup – aus meiner Sicht eine sehr sanfte, langsame Eingewöhnung, die sowohl den Kindern als auch Eltern Zeit gibt, sich an den Kindergartenalltag zu gewöhnen.
Sie gibt viel Raum und Zeit um die Erzieherinnen, die anderen Kinder, die Räumlichkeiten und auch Rituale kennenzulernen. Die Kinder haben die Möglichkeit, sich Stück für Stück nach eigenem Zutrauen vom Sitzplatz der Eltern zu entfernen und auf „Entdeckungsreise“ zu gehen.
Sie dürfen die Sicherheit erfahren, dass ihre Eltern an dem gleichen Ort wiederzufinden sind.
Wir Erzieherinnen sind bemüht, Kontakt zu jedem Kind aufzubauen. So wird ein gegeseitiges Kennenlernen gefördert, den Kindern wird dennoch die Chance gelassen sich eine Bezugsperson auszusuchen.
Oft gelingt es sehr schnell das Vertrauen der Kinder zu gewinnen, sodass wir Erzieherinnen nach und nach immer mehr Aufgaben übernehmen können, die sonst den Eltern vorbehalten waren. Natürlich gelingt dieses besonders gut, wenn Eltern bereit sind zuzulassen, dass die Kinder die ersten „Abnabelungsversuche“ unternehmen und diesen Prozess bereitwillig unterstützen.
Für die Eltern bedeutet diese Art der Eingewöhnung, dass sie viel Zeit in die ersten Wochen investieren müssen und sie verlangt auch eine gewisse Art von Flexibilität ab. Hat ein Kind schon tolle Fortschritte gemacht und kann schon für kurze Zeit „alleine“ im Kindergarten bleiben, werden die Eltern in die Elternecke der Einrichtung oder bei kurzem Weg auch nach Hause geschickt.
Da alle Eltern während der Eingewöhnung an einem festen Platz sitzen, in unserem Fall ist das der Nebenraum, bekommen sie auch die Fortschritte der anderen Kinder mit und müssen es auch aushalten, wenn andere Kinder schnellere Fortschritte machen als das eigene Kind.
Ich bevorzuge diese Art der Eingewöhnung, da die Eltern und die Kinder dort abgeholt werden, wo sie gerade stehen. Sie bietet viel Raum und Zeit zum Kennenlernen, gibt den Erzieherinnen gute Beobachtungsmöglichkeiten, um individuell auf die Kinder einzugehen (z.B. wie das Kind getröstet wird, welches Spielzeug besonders interessant ist…).
Als wichtig erachte ich es auch, dass die Kinder mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und gerne in den Kindergarten zurückkehren. Deshalb sollten die Spielphasen in den ersten Tagen von kurzer Dauer sein und dann langsam ausgeweitet werden.
Und zum Abschluss die Sicht einer Mutter
Unsere Tochter, 1,7 Jahre, geht seit August 2021 in den Kindergarten. In der Einführungszeit fühlten wir uns als Eltern sehr gut aufgehoben. Die Interaktion mit den Kindern/Eltern erfolgte, trotz Coronabedingungen, sehr intensiv. Unsere Tochter hat schnell Vertrauen zu den Fachkräften gefunden, was wohl auch daran liegt, dass diese alle jederzeit freundlich und offen gegenüber den Kindern und auch den Eltern sind.
In diesem ersten halben Jahr können wir von einer durchaus positiven Entwicklung unserer Tochter sprechen. Wir merken, dass mit den Kindern jeden Tag intensiv interagiert wird. Sei es sprachlich, musikalisch oder auch in der Bewegung. Ihr Wortschatz wächst von Tag zu Tag. Dazu tanzt und singt sie gerne. Auch scheint sie bereits erste engere Verbindungen mit einigen Kindern aufzubauen, da drei bis vier Namen auch außerhalb des Kindergartens eine Rolle spielen. In der Regel ist sie immer positiv gestimmt, wenn wir sie aus dem Kindergarten abholen. Auch morgens freut sie sich, wenn wir sie hinbringen. Für uns ein Zeichen, dass sie sich wohlfühlt und ihr eure Arbeit mit viel Engagement ausübt. Auch ihr Sozialverhalten wird durch den Kindergarten positiv beeinflusst. So signalisiert sie, was sie möchte und sagt auch Nein, wenn es ihr zu viel wird. Das Teilen/Abgeben von Spielsachen klappt ebenfalls schon sehr gut.
Positiv erwähnen möchten wir auch unser erstes gemeinsames Gespräch, wo wir unsere gegenseitigen Erfahrungen bezüglich der Entwicklung unserer Tochter austauschen konnten. Trotz der Coronabedingungen fühlen wir uns von den Fachkräften der Gruppe jederzeit mitgenommen. Der kurze Austausch über den Tag beim Bringen/Abholen finden wir sehr gut.
Mehr über das Modell
Soweit die Stimmen aus der Praxi und den Erfahrungen mit der Peergroup-Eingewöhnung. Ich wünsche mir, dass sie dich vielleicht noch ein bisschen neugieriger auf diese Eingewöhnung gemacht haben.
Wenn du mehr über die Peergroup-Eingewöhnung erfahren möchtest. Im Oktober erscheint mein Buch: Peergroup-Eingewöhnung im Verlag an der Ruhr. Du kannst es schon jetzt im Buchhandel oder im Shop des Verlages vorbestellen.
von Anja Cantzler | 21.01.2021 | Bindung und Eingewöhnung
Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit den verschiedenen Eingewöhnungsmodellen. Seinen Anfang nahm dies bereits in meiner Zeit als Pädagogische Fachkraft vor mehr als 25 Jahren als ich merkte, dass die damalige Form der Eingewöhnung ohne Elternbegleitung für alle Beteiligten einfach nur anstrengend und für die Kinder wenig bedürfnisorientiert war.
Das Berliner Modell als Lösung
Wie glücklich war ich als ich dann das Berliner Eingewöhnungsmodell kennenlernte und dies dann mit viel Überzeugung in meinen Seminaren vermittelte. Vor gut 20 Jahren war das sehr innovativ. Seither haben sich viele Spielarten hierzu entwickelt und meiner erfahrung nach setzt kaum eine Einrichtung tatsächlich dieses Modell in Reinform um. Mittlerweile hinterfrage ich, ob eine Einrichtung in ihrem Konzept überhaupt ein konkretes Modell benennen sollte oder ob es nicht viel sinnvoller ist, das zu beschreiben, was in der einzelnen Krippe, Kita oder Kindertagespflege konkret praktiziert wird. Für den Fall, dass Du Dein Eingewöhnungskonzept hinterfragen und ggfs. überarbeiten möchtest, habe ich Dir 5 Tipps zur Eingewöhnung zusammengestellt. Der kostenfreie E-Mail Kurs begleitet Dich über mehrere Tage mit gezielten Reflektionsfragen dabei.
Im Laufe der Jahre lernte ich als Referentin noch das Münchner Modell kennen. Das Berliner Eingewöhnungsmodell basiert im Kern auf der Bindungstheorie und das Müncher bezieht darüber hinaus, die Transitionsforschung mit ein, die u.a. davon ausgeht, dass ein Kind auch zu mehreren anderen Erwachsenen in einem Eingewöhnungsprozess mit der entsprechenden Zeit eine Beziehung aufbauen kann.
Neue Impulse eröffnen neue Wege
2016 hat es dann auf einer Tagung des Netzwerk: Fortbildung U3 in Potsdam bei mir nochmal richtig Klick gemacht. Ich begegnete im Open Space Regine Schierle-Wenger, die uns das Modell der Eingewöhnung in der PeerGroup vorstellte. Ihre Begeisterung sprang unmittelbar auf mich über, so dass ich bereits in der folgenden Woche, dieses Modell in meiner Fortbildungsreihe „Fachkraft für Frühpädagogik“ im Haus Neuland aufnahm. In dieser Gruppe entzündete sich in einer Kollegin ein Feuer, dass sie umgehend in ihre Einrichtung trug und innerhalb von knapp 4 Monaten die Eingewöhnung für ihre Krippengruppe veränderte.
Seither ist die Eingewöhnung in der Peer Group ein fester Bestandteil in meinen Seminaren und Modulen rund um die Eingewöhnung. Was aber beinhaltet dieses Eingewöhnungsmodell im Kern? – Meines Erachtens ist dieses Model die aktuelle und logische Weiterführung der beiden anderen Modelle. Es berücksichtigt die Wichtigkeit der Bindungspersonen für die Gestaltung von Übergängen auf Grundlage der Bindungstheorie, es integriert die Annahme, dass Kinder grundsätzlich auch zu mehreren anderen Erwachsenen Beziehungen aufbauen können gemäß der Transitionsforschung und es bezieht die Bedeutung der Gleichaltrigen basierend auf den Forschungen zur Peer Group mit ein. Ein sehr lesenswertes Buch hierzu heißt: Was wir gemeinsam alles können.
Die Bedeutung der Peer Group
Die Forschungen von Carolin Howes zu den Peer Group Beziehungen bei Kindern von 0-3 Jahren haben ergeben, dass bereits Kinder gegen Ende ihres ersten Lebensjahres mit anderen Gleichaltrigen sozial interagieren. Sie bearbeiten ab diesem Alter bereits gemeinsam emotionale Themen im gemeinsamen Spiel. So hat Howes auch herausgefunden, dass die Trennung von den Eltern den Kindern leichter fällt, wenn sie diese mit anderen Kindern bewältigen, die in der gleichen Situation sind. So kann beispielsweise ein Kind, dass sich mit Trennung etwas schwerer tut, sich das Verhalten und die emotionale Ebene bei einem anderen Kind, dem es weniger schwer fällt abgucken.
Und so geht`s
Bei der Eingewöhnung in der Peer-Group werden in der Regel je nach Alter 3-5 Kinder in Begleitung ihrer Eltern gleichzeitig eingewöhnt. Zwei Eingewöhnungspädagoginnen begleiten den Eingewöhnungsprozess. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, eine anregende Umgebung zu schaffen, in der die Kinder miteinander ins Spiel kommen und so sich gut von den Eltern lösen können. Sie beobachten jedes einzelne Kind und die Kindergruppe, um herauszufinden, wer wann welche Unterstützung braucht, um gut ankommen zu können. Am Anfang bleiben die Eltern als Gruppe mit im Raum, so dass die Kindern jederzeit zu den Eltern zurückkehren können und wieder Sicherheit auftanken können. In dieser Phase nehmen bereits einzelne Kinder auch Kontakt zu den Eingewöhnungspädagoginnen auf, die dann feinfühlig eine Beziehung zu dem jeweiligen Kind aufbauen. Auch hier lernen die anderen Kinder durch Beobachtung und Nachahmung am Modell.
Die Eltern verlassen nach ca. 3-5 Tagen erstmalig den Raum, wenn möglich gemeinsam. Ähnlich anderer Eingewöhnungsmodelle ist jetzt die Reaktion des einzelnen Kindes im Vordergrund und für das weitere Vorgehen ausschlaggebend. Selbstverständlich kommt ein Elternteil sofort wieder zurück, wenn ein Kind noch Zeit braucht. Hier gilt der Vorrang des individuellen Bedürfnisses vor dem der Gruppe. Erfahrungsgemäß ist es für die anderen Kinder, die die Trennung schon gut meistern kein Problem, wenn ein einzelnes Elternteil noch anwesend ist. Die Dauer der Abwesenheit der Eltern wird dann schrittweise verlängert. Ein ganz besonderer Charm dieses Modells liegt übrigens darin, dass auch die Eltern eine Peer Group bilden und sich so gemeinsam stützen.
Generell sind folgende Säulen zu beachten:
- das Team
- die Eingewöhnungspädagogen
- die Kindergruppe
- die Eltern
- der seperate vorbereitete Raum mi Spiel- und Elternbereich
Rückmeldung aus der Praxis
Ich kenne mittlerweile einige Einrichtungen, die dieses Modell mit Überzeugung umsetzen und die Rückmeldungen sind jedes Mal sehr ähnlich: die Eingewöhnung verlief entspannter, die Kinder finden sehr gut ins Spiel, die Ablösung findet stressfreier und mit geringerer Rückfallquote statt, die Kinder wenden sich an die pädagogischen Fachkräfte im Bedarfs- und Trostfall, sind aber weniger fixiert auf eine spezielle Bezugserzieherin …
Soweit ein erster kleiner Einblick in dieses etwas andere Modell. Wenn Du mehr darüber erfahren möchtest, habe ich Dir noch ein paar Empfehlungen im Anhang verlinkt. Falls du bereits mit dem Modell arbeitest freue ich mich über Deine Erfahrungswerte in den Kommentaren. Solltest weitere Fragen haben, kannst Du diese auch gerne in die Kommentare schreiben oder Du kommst in eines meiner Live-Online-Seminare.
Deine Anja
In meinem Kita Talk: Eingewöhnung in der Peer Group berichtet Sabrina Djogo über die Umsetzung des Modells in der Kindertagespflege
In dem Podcast von Tanja Köster wurde ich zu dem Modell interviewt.
Live-Online-Seminare
6.11.2021 Haus Neuland/ Sennestadt: Eingewöhnung in der Peer Group
von Anja Cantzler | 12.01.2021 | Bindung und Eingewöhnung
Das neue Jahr hat gerade erst angefangen und nun ist es sehr deutlich, dass der erneute Lockdown noch bis mindestens Ende Januar gehen wird. Irgendwie ist gerade kein Ende in Sicht und trotzdem sollten wir den Blick nach vorne richten. Auch wenn gerade nicht klar ist, wie es konkret weitergeht, fest steht, dass früher oder später neue Kinder und Eltern in den Gruppen aufgenommen werden. Aufnahme und Eingewöhnung ist ein immer wiederkehrendes Thema in Kita und Kindertagespflege. Die Eingewöhnung ist die Basis für alles weitere: zum einen mit Blick auf die Entwicklung des Kindes und zum anderen mit Blick auf die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Eine Eingewöhnung ist in der Regel nicht nach zwei bis drei Wochen abgeschlossen, je nach Kind dauert sie auch gerne 12 Wochen und länger. Meines Erachtens ist es sehr wichtig und wertvoll, sich immer wieder mit der Gestaltung einer sanften und bedürfnisorientierten Eingewöhnung im gesamten Team zu beschäftigen.
Viele Einrichtungen befinden sich aktuell in den Anmelde- und Aufnahmeverfahren für den Sommer. Genau der richtige Zeitpunkt, um das eigene Eingewöhnungskonzept einmal gut zu überdenken und eventuell zu überprüfen. Dazu habe ich bereits im letzten Jahr die 5 Tipps zur Eingewöhnung entwickelt. Hierbei handelt es sich um einen mehrteiligen E-Mail Kurs, mit dessen Hilfe Du über eine Woche hinweg Deine Eingewöhnung reflektieren und überprüfen kannst.
Ergänzende Blogartikel
Ergänzend dazu habe ich im letzten Jahr bereits viele Blogbeiträge rund um die Eingewöhnung veröffentlicht. Zur besseren Übersicht findest Du hier eine Aufstellung der verschiedenen Beiträge:
Für alle, die sich im Speziellen für die Eingewöhnung in der Peer-Group interessieren, ist ganz aktuell mein YouTube KitaTalk mit Sabrina Djogo, die seit vielen Jahren als Tagespflegekraft arbeitet, erschienen.
Termine für Online-Seminare
Im nächsten Blog-Beitrag befasse ich mich etwas ausfühlicher mit der „Eingewöhnung in der Peer-Group“. Wenn du an einem Seminar zu diesem Thema interessiert bist, gibt es an folgenden Terminen Live-Online Seminare:
Beliebte Podcasts
Sehr hörenswerte Podcasts von anderen Expertinnen zu dem Thema Eingewöhnung findest Du unter:
Buchtipps
Vor ein paar Jahren habe ich ein Buch zum Thema: Eingewöhnung von KiTa Kindern veröffentlicht. Hier bekommst Du einen ersten Ein- und Überblick in die Eingewöhnung in der Kita. Es ist für Fachkräfte und Eltern geschrieben, die einen kleinen Ratgeber zu diesem Thema suchen.
Das Krüger & Thiel Institut hat eine kleine Broschüre mit dem Titel: Sanfte Eingewöhnung für mein Kind veröffentlicht. Die Broschüre bestehen aus liebevoll zusammengestellten Fotos mit Szenen aus dem Eingewöhnungsalltag einer KiTa. Hier wird den Kindern eine Stimme gegeben und somit ihre Sichtweise auf die Eingewöhnung verdeutlicht. Die Erwachsenen bekommen Handlungsanregungen für die Gestaltung und Begleitung des Eingewöhnungsprozesses. Sehr hilfreich und empfehlenswert für die Zusammenarbeit mit Eltern.
Für Kinder in der Eingewöhnung hat das Krüger&Thiel Institut ein ganz reizendes kleines Bilderbuch: Mira, Tuffi und die Gefühle veröffentlicht. Hier begleitet der kleine Stoffelefant Tuffi die kleine Mira in ihrern ersten Kindergartentagen und beschreibt ihre Gefühle. Sehr schön, für die Gruppe oder als kleines Willkommensgeschenk für die neuen Kinder.
Für Teams, die sich von Grund auf mit Bindung und Beziehungsaufbau beschäftigen möchten, kann ich die Arbeitsmaterialien „Bindung entsteht – Bindung stärkt – Bindung trägt“ von Gundula Göbel empfehlen. Zu dem Paket gehören viele Broschüren in einfacher Sprache, die gut an Eltern weitergegeben werden können. Highlights sind die Schaubilder des Bindungsbaums und der Trosttankstelle.
Andere Materialien
Und zu jeder guten Eingewöhnung gehört natürlich auch die Portfolioarbeit. In diesem Rahmen hat Sandra Warsewicz von der Werkstatt der Guten Gedanken sehr schöne Vorlagen entwickelt. s lohnt sich da mal durch ihre Seite zu stöbern.
Soweit dieses Mal, ein paar Tipps und Empfehlungen rund um die Eingewöhnung. Bleib gesund und pass gut auf Dich auf. Das Gute ist, irgendwann geht auch diese Zeit vorbei und dann bist Du gut auf die Zeit „danach“ vorbereitet.
Deine Anja
von Anja Cantzler | 23.06.2020 | Allgemein
In den vergangenen Tagen wurde ich bei meinen Seminaren und Supervisionen gefragt, wie die Eingewöhnung der neuen Kinder im Sommer und Herbst aussehen kann. Im Dialog mit Fachkräften begegnen mir diesbezüglich viele Unsicherheiten, wie die bestehenden Konzepte zur Eingewöhnung unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln umzusetzbar sind.
Gemeinsam mit Fachkräften habe ich hierzu verschiedene Überlegungen mit Fokus auf das jeweilige Eingewöhnungsmodell zusammengetragen.
Das Berliner Eingewöhnungsmodell eröffnet demnach folgende Varianten:
- Die Eingewöhnung findet gemäß des eigentlichen Berliner Eingewöhnungsmodells mit einem Elternteil, dem Kind und einer Pädagogischen Fachkraft in einem seperaten Raum, getrennt von der Gruppe statt. Erst wenn das Kind die Pädagogische Fachkraft als Bezugsperson akzeptiert hat, gehen Kind und Pädagogische Fackraft zu den anderen Kindern der Gruppe. Hier kommen die Eltern nicht mit den anderen Kindern in Kontakt. Diese Variante ist jedoch personalintensiv.
- Ein Elternteil und ein Kind kommen zu einer vereinbarten Zeit in die Gruppe. Gemeinsam gehen Eltern, Kind und Pädagogische Fachkraft Hände waschen. Das Elternteil bekommt einen festen Platz in einer Elternecke, die für die anderen Kinder möglichst tabu ist. Eltern und pädagogische Fachkraft wahren den Abstand, so dass weitestgehend auf den Mund-Nasenschutz verzichtet werden kann. Alternativ tragen beide ein Visir, so dass das Kind sich an der Mimik von Eltern und Pädagogischer Fachkraft orientieren kann. Wenn die Eltern während des Trennungsversuchs den Gruppenraum verlassen und in einen anderen dafür vorgesehenen Raum wechseln, muss auf den Mund-Nasenschutz geachtet werden.
Beim Münchner Modell steht im Unterschied zum Berliner Eingewöhnungsmodell dem neuen Kind mit seinem Elternteil ein längerer Zeitraum zur Verfügung, um am Tagesablauf der Gruppe teilzunehmen und die Kita zu erkunden. Das bedeutet mit Blick auf die Hygiene- und Abstandsregeln, dass der Zeitraum, in dem die Eltern sich und andere einem erhöhtem Infektionsrisiko aussetzen höher ist. Es bedarf klarer Absprachen bezüglich des Umgangs mit dem Mund- und Nasenschutz oder dem alternativen Einsatz eines Visirs. Die Erkundung des Tagesablaufs und der Einrichtung begrenzt sich auf das Geschehen in der Gruppe und im Außengelände, da eine Durchmischung mit anderen Gruppen unerwünscht ist.
Bei der Eingewöhnung in der Peer-Group werden 3- 5 Kinder in Begleitung ihrer Eltern gleichzeitig eingewöhnt. In der Regel sind 2 Eingewöhnungspädagoginnen für die Eingewöhnung zuständig. Normalerweise wird für die Eltern eine Elternecke eingerichtet, in der die Eltern miteinander in Kontakt kommen können. Auch hier bieten sich verschiedene Varianten:
- Die Eltern sitzen in angemessenem Abstand zueinander im Raum verteilt und können so auf den Mund-Nasenschutz verzichten.
- Die Eltern tragen ein Visir, um in der Elternecke miteinander ins Gespräch kommen zu können und den Abstand nicht ständig einhalten zu müssen.
Erst wenn die neu gebildete Kindergruppe sich von den Eltern gelöst hat, kommen diese Kinder mit den anderen Kindern der Gruppe in Kontakt. Die Eltern haben so keinen Kontakt mit den anderen Kindern.
Bei gutem Wetter kann ein Teil der Eingewöhnung in Absprache mit den anderen Gruppen nach draußen verlegt werden, um das Infektionsrisiko zusätzlich zu minimieren.
Da glücklicherweise mittlerweile das Betretungsverbot für Eltern aufgehoben ist, kann mit ein paar Anpassungen auch weiterhin eine kindgerechte Eingewöhnung stattfinden. Wichtig ist, dass unabhängig vom jeweiligen Modell die Eingewöhnung elternbegleitet, bezugspersonenorientiert und abschiedsbewusst durchgeführt wird. Zusätzlich brauchen Kinder eine klare Mimik der Eltern und Pädagogischen Fachkräfte, um sich in dieser neuen Situation orientieren zu können, deswegen bieten m.E. Visire während der Eingewöhnung eine gute Alternative.
Und vergesst bei allen Abstands- und Hygieneregeln nicht, Abschiedsrituale mit den Kindern zu entwickeln und Übergangsobjekte zur Unterstützung zu erlauben. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit einen Gegenstand wie z.B. Schnuller, Kuscheltier, Schmusetuch o.ä. In der Kita zu deponieren, der dort auf das Kind wartet, um ihm eine Brücke in die Gruppe zu bauen und nach Bedarf als Tröster zur Verfügung zu steht. Oder Ihr gestaltet mit den Eltern ein ICH-Buch, auf das das Kind dann immer wieder zurückgreifen kann, wenn es traurig ist.
Wenn Ihr Eure Eingewöhnung generell gerne überprüfen und überarbeiten möchtet, dann könnt Ihr Euch hier kostenlos und unverbindlich meine „5 Tipps zur Gestalltung einer Eingewöhnung“ holen. Dort bekommt Ihr viele zusätzliche Anregungen für die Vorbereitung der Eingewöhnung im Team, der Zusammenarbeit mit den Eltern und der Einbeziehung der Peer Group in die Eingewöhnung.
Ich wünsche Euch einen guten Start mit den neuen Kindern und Eltern
Eure Anja
P.S. Ich gehe jetzt für die nächsten 4 Wochen mit meinem Blog in die Sommerpause. Im August melde ich mich mit neuen Themen wieder. Dann stehe ich auch wieder für Seminare, Webinare, Coachings und Supervisionen zur Verfügung. Ich wünsche Euch eine schöne Sommerzeit.
Falls Ihr mit Euren Kindern eine Zeitkapsel gestaltet habt oder gestalten werdet. Denkt daran mir die Fotos zu schicken, damit ich sie hier im Block veröffentlichen kann: anjacantzler@t-online.de
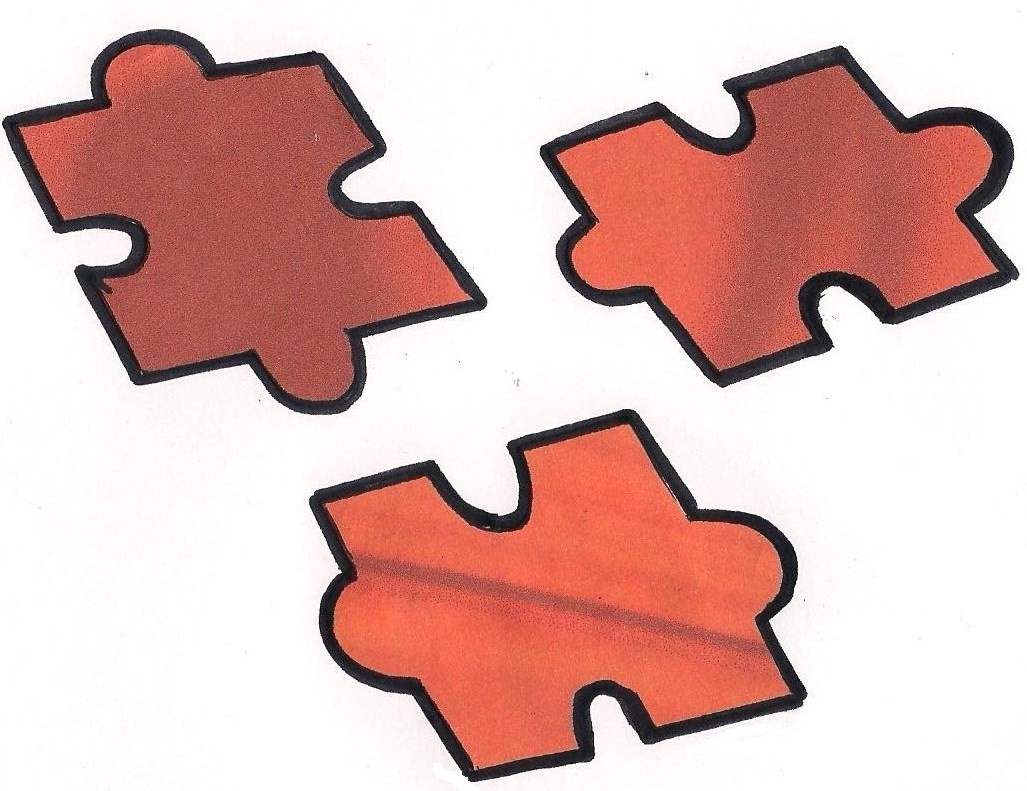
Neueste Kommentare