von Anja Cantzler | 8.03.2022 | Konflikte, Methoden, Team
Sobald ein Kind zu dir in die Krippe, Kita oder Kindertagespflege kommt, wird es Teil einer ihm völlig fremden Gruppe und muss sich den bestehenden Gruppenregeln und den dort vermittelten Werten unterordnen. Die Kinder bringen erste Werte bereits aus dem Elternhaus mit und gleichzeitig vermittelst du bewusst oder unbewusst den Kindern deinerseits von Anfang an Werte, die dir wichtig sind. So wie die Kinder aus ihrem familiären Umfeld geprägt sind, bist du als pädagogische Fachkraft ebenfalls von den Werten deiner eigenen Familie und deiner bisherigen Lebensgeschichte geprägt. Jeder Mensch – Kinder, Eltern, Kollegen, Kolleginnen und du selbst – hat seine individuellen, persönlichen Werte.
Was sind eigentlich Werte?
Werte sind zunächst einmal allgemeine, kollektiv geteilte Vorstellungen darüber, was die Mitglieder einer Gesellschaft für wünschenswert erachten. Diese Werte prägen deine Persönlichkeit und sind entscheidend für dein Handeln in den unterschiedlichsten Lebenslagen. In deiner Arbeit dienen sie dir als Orientierung für die eigene Einstellung und als “Regulierer” des Denkens, Fühlens und Handelns im Umgang mit den Kinder, Eltern und Mitarbeitenden in ihrer pädagogischen Tätigkeit.
Als Fachkraft solltest du dir bewusst sein, dass du gemeinsam mit dem Elternhaus die Wertehaltung der Kinder mitprägst. Dementsprechend wichtig ist es, dass du dir deiner Werte bewusst bist und den Kindern von Beginn an positive Werte mit auf den Weg gibst.
Werte lassen sich grundlegend in vier Kategorien unterteilen. Es gibt:
-
Geistige Werte (Wissen, Disziplin)
-
Sittliche Werte (Treue, Ehrlichkeit)
-
Religiöse Werte (Toleranz, Glaubensfestigkeit)
-
Private Werte (Höflichkeit, Rücksichtnahme oder Taktgefühl)
Unterm Strich stellen Werte wie Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Toleranz etc. positive Charakterzüge dar. Werte beinhalten immer etwas positives. „Schlechte Werte“ gibt es grundsätzlich nicht.
Trotzdem kommt es in der pädagogischen Arbeit immerwieder zu sog. Wertekonflikten, weil ein Elternteil regelmäßig morgens zu spät kommt, die Kollegin ständig irgendetwas herumliegen lässt oder der Kollege das Kind mit dem Essen spielen lässt.
Was versteht man unter Wertekonflikten?
Ein Wertekonflikt entsteht dann, wenn zwei Werte so im Gegensatz zueinander stehen, dass sie nicht gleichzeitig zu berücksichtigen sind. Im Fall des zu spät kommenden Elternteils kann der Wert der Pünktlichkeit berührt werden, die Kollegin verletzt den Wert der Ordnung und Ordentlichkeit und der Kollege stellt den Wert, Lebensmittel nicht zu verschwenden, möglicherweise in Frage.
Wenn die Situationen mit einem klaren Gespräch nicht lösbar sind, kann dir das Werte- und Entwicklungsquadrat nach Schulz von Thun gegebenfalls weiterhelfen.
Was verbirgt sich hinter dem Werte- und Entwicklungsquadrat?
Es handelt sich um ein weiteres Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun. Mit diesem Modell wird verdeutlicht, dass sich hinter jedem Wert ein Unwert verbirgt und hinter jedem Unwert ein Wert. (s.Abbildung 34/ Beitragsbild) Damit wird es dir u.a. möglich das Gute in deinen Schwächen zu sehen.
Wenn du dich auf den Weg machst und das Gute hinter deinen Schwächen und den Schwächen der anderen erkennst, aber auch das Schlechte hinter den Stärken, erfährst du mehr über dich selbst und andere. Du kannst entdecken, an wo es bei dir und bei deinem Gegenüber Entwicklungspotenziale gibt. Damit wird es dir oftmals leichter, dem Verhalten anderer gegenüber gelassener zu reagieren. Das Wertequadrat ist damit eine wunderbare Methode für mehr Selbsterkenntnis und einen gelasseneren Umgang mit Menschen mit anderen Ansichten.
Oftmals ist es auf den ersten Blick nur schwer erkennbar, dass sich hinter unerwünschten Eigenschaften wie Festhalten an Gewohntem, strengen Vorgaben, Selbstaufgabe, Egoismus, Misstrauen etc. letztendlich ein Wert bzw. Stärke verbergen. Manches Mal muss du dann sehr genau hinschauen, um den hinter jedem Wert dazu gehörigen „Geschwister“wert zu erkennen. Diese gegensätzlichen Paare sind wichtig, damit aus einem Wert kein Unwert wird. Unter einem Unwert versteht man die abwertende Übertreibung des eigentlichen Wertes. Dann dann die Pünktlichkeit auch einmal in eine Betonung der Überpünktlichkeit ausarten oder der Anspruch auf Genauigkeit wird zur zwanghaften Perfektion.
Ein Beispiel zur Verdeutlichung
In der Zusammenarbeit pädagogischer Fachkräfte untereinander oder aber auch im Dialog mit den Eltern kommt es in der Praxis immer wieder zur Reibungen durch unterschiedlichen Wertehaltungen.
So möchte deine Kollegin oder dein Kollege beispielsweise den Kindern klare Grenzen vorgeben, was sie tun und lassen dürfen. (Wert2: Anleitung/ Führung) Du vertritts hingegen die Ansicht, dass ein Kind sich am besten entwickeln kann, wenn es frei und ohne viele Vorschriften von außen seine Erfahrungen machen darf. (Wert1: freie Entfaltung)
Du beschuldigst dann vielleicht deinen Kollegin oder deinen Kollegen als zu streng und einengend (Unwert2), wodurch die Kinder sich nicht entfalten können. Deine Kollegin oder dein Kollege beürchten ihrerseits bei dir eine Laissez-Faire-Haltung (Unwert1), die dazu führt, dass das Kind schon bald nur noch machen wird, was es will.
Wertequadrat für das Beispiel:
-
|
Wert1
freie Entfaltung
|
|
|
Wert2
Anleitung/ Führung
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unwert1
Laissez-Faire
mach doch, was du willst
|
|
|
Unwert2
strenge und starre Vorgaben
|
Wenn du nun die Werte und die dazugehörigen Unwerte in das Wertequadrat einträgst (s.Abb) wird schnell deutlich, dass alle Beteiligten eigentlich für einen Wert auf der oberen Linie eintreten und es eigentlich nicht grundsätzlich darum geht, den anderen zu verteufeln, indem wir ihn auf einem der unteren Unwerten verdammen.
Hilfreich ist nun gemeinsam die sogenannte „goldene Mitte“ zu finden. Jede*r betont aus seiner Sicht einen Teil der Gesamtwahrheit. Die Lösung besteht darin, sich im Optimalfall nicht zu widersprechen, sondern sich in der Gegensätzlichkeit zu ergänzen.
Ohne ein gewisses Maß an Vorgaben wird aus der freien Entscheidungs- und Entwicklungsmöglichkeit für die Kinder schnell eine orientierungsloses Laissez-Faire. Umgekehrt begünstigen zu viele Regeln und Vorgaben eine starre und strenge Atmosphäre, in die Kinder zu sehr beschnitten werden, was wiederum dem Partizipationsansatz komplett widerspricht.
Die Lösung des Wertekonfliktes
Die Lösung eines Wertekonfliktes liegt also in der Überwindung der anscheinenden Polarität, der scheinbaren Unvereinbarkeit zweier an sich ergänzender Bruderwerte. Basis ist die Erkenntnis, dass zwei Teilwahrheiten / Geschwisterwerte im Idealfall in einem flexiblen Ergänzungsverhältnis zueinander stehen. Das unterstützt dich dabei, in einem Konfliktfall von der Verteufelung deines Gegenübers und seiner Werte abzulassen und zu erkennen, dass auch dein Kollege, deine Kollegin oder die Eltern für einen wertvollen Teilaspekt eintreten.
Erinnere dich also im nächsten Wertekonflikt daran: „Egal wie unmöglich und gefährlich du du die Ansichten deines Gegenübers auch findest, freue dich, dass es diese andere Seite gibt. Dein Gegenüber macht dich nämlich darauf aufmerksam, dass auch in deinen Werten Unwerte schlummern, die sich potenzieren können, wenn dein Gegenüber nicht wäre.“
Was bringt dir das Werte- und Entwicklungsquadrat?
Zum einen kannst du dich selbst reflektieren. Wenn du beispielsweise unter einer bestimmten Eigenschaft oder Schwäche leidest, kannst mithilfe des Werte- und Entwicklungsquadrates erkennen, in welche Richtung du dich entwickeln solltest.
Wenn du oftmals darum bemüht bist, es allen Recht zu machen und dabei deine eigenen Bedürfnisse vernachlässigst, bist gut beraten, einen gesunden Egoismus zu entwickeln. Neigst du dazu eher zu dominant und kontrollsüchtig zu sein, übe dich im Los- und Zulassen.
Außerdem hilft dir das Wertequadrat zu erkennen, dass hinter jedem Unwert oder jeder Schwäche das Potenzial eines Wertes oder einer Stärke angelegt ist.
Wenn du in der Lage bist, das zu erkennen, hilft dir das, deine eigenen Schwächen besser anzunehmen. Wenn du erkennst, dass hinter deiner unerwünschten Charaktereigenschaft immer auch eine an sich positive Eigenschaft angelegt ist, kannst du dich vielleicht weniger dafür kritisieren.
Dieser Blickwinkel kannst du natürlich auch gegenüber anderen einnehmen und damit gelassener reagieren, wenn dir etwas an deseen Verhalten missfällt. Schließlich weißt du nun, dass in jeder “Schwäche” bzw. übertriebenen Eigenschaft auch ein wertvolles Potenzial angelegt ist. Alles angeblich „Schlechte” hat also einen positiven Kern. Das lässt sich übrigens auch auf die pädagogische Arbeit mit den Kindern übertragen. Anstatt dich über das widerspenstige Kind zu ärgern, kannst du dich über so viel Durchsetzungsfähigkeit freuen.
Schließlich ist das Werte- und Entwicklungsquadrat auch bei zwischenmenschlichen Konflikten sehr hilfreich. In meinem vorherigen Beispiel wurde der Kollege bzw. die Kollegin kritisiert. Der Kritisierte verkörpert für den Kritisierenden ausschließlich negative Ansichten und Eigenschaften, wohingegen er selbst für das Gute und Wertvolle steht. Hier führt die Anwendung des Werte- und Entwicklungsquadrats zu mehr Gelassenheit in der Situation, wenn damit die gegensätzlichen Standpunkte aufgelöst werden.
Ich wünsche dir, dass du zu mehr Dialog und Gelassenheit mit diesen Anregungen finden kannst
Deine Anja
Ergänzender Kita Talk:
Wenn du jetzt gerne noch mehr über den Umgang mit Wertekonflikten erfahren möchtest, dann hör doch ganz einfach in meinen KitaTalk mit Martina Korn: „Meine Werte- Deine Werte, wenn Werte zum Konflikt führen“
Und hier noch eine Übung zum Werte- und Entwicklungsquadrat nach Schulz von Thun
Zugegeben, es ist für unseren polar geprägten Verstand nicht immerganz einfach, hinter einem Wert den dazugehörigen Geschwisterwert zu finden bzw. hinter zwei sich auf den ersten Blick gegensätzlichen Werten die entsprechende Ergänzung zu finden.
Fertige doch einfach mal zu jedem der folgenden Begriffe ein Wertequadrat an, dann bekommst du ein besseres Gespür dafür.
a) Starr an Altem festhalten
b) Albernheit
c) Selbstaufgabe / Selbstaufopferung
Tipp: Überlege dir zunächst, ob es sich bei dem Begriff um einen Wert oder eine Übertreibung/Entartung handelt. Einen Wert trägst du immer oben ein, eine Übertreibung nach unten (egal ob links oder rechts).
Finde dann zu einem Wert seinen Geschwisterwert bzw. zu der Überreibung den dahinter liegenden Wert.
Beispiel: Faulheit
-
|
Wert 1
zielstrebiger Ehrgeiz
|
|
|
Wert2
entspannte Gelassenheit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unwert 1/ Übertreibung 1
übertriebener Ehrgeiz/Nicht locker lassen können/
Verbissenheit
|
|
|
Unwert2/
Übertreibung 2
Faulheit/Trägheit/ übertriebene Passivität
|
von Anja Cantzler | 17.09.2021 | Gewaltfreie Pädagogik, Kinderschutz, Methoden
Die Wahrnehmung des eigenen Körpers und des eigenen Ichs im Sinne von „Wer bin ich?“, „Was kann ich?“ und „Was will ich?“ bilden für mich wichtige Grundbausteine für gelebten Kinderschutz in der Kinderbetreuung und tragen zur Prävention bei.
Sensomotorisches Spiel als Grundlage
In den ersten drei Lebensjahren widmen sich Kinder in erster Linie ausgiebig dem sensomotorischen Spiel, der ersten Form kindlichen Spielens. Sie bestaunen und erforschen zunächst ihren Körper und später ihre dingliche Umwelt. Dabei sind häufige Wiederholungen mit kleinen Variationen von großer Wichtigkeit. Um dies in Ruhe tun zu können brauchen Kinder ungestörte Rückzugsorte und viel Zeit. Eines der größten Tastorgane ist unsere Haut. Darüber erhält der Körper wesentliche Impulse, die im Gehirn verarbeitet und gespeichert werden und einen großen Einfluss auf die motorische, sprachliche und emotionale Entwicklung haben.
Wickeln feinfühlig gestalten
In dem Zusammensein mit jüngeren Kindern bietet gerade die Wickelzeit zahlreiche Möglichkeiten, dem Kind individuelle Zuwendung und ein vielfältiges Lern- und Erfahrungsfeld anzubieten. Das Wickeln ist eine stark von Intimität und Vertrauen geprägte Situation, bei der durch den Körperkontakt der Bindungsaufbau zwischen Kind und Pädagogischer Fachkraft unterstützt wird. Im Sinne des Kinderschutzes und der Prävention ist es hier sehr wichtig sehr feinfühlig auf das einzelne Kind einzugehen. Dazu gehört es, den Blickkontakt zu halten und darauf zu achten, dass dem Kind die Berührungen angenehm sind und es sich wohl fühlt. Was dem einen Kind angenehm ist, empfindet das andere als extrem unagenehm. Bitte reflektiere Dich auch immer selbst, ob der Wunsch nach diesem Körperkontakt wirklich vom Kind ausgeht oder ob Du es ihm förmlich überstülpst, weil Du es gerade genießt mit dem Kind im Kontakt zu sein. Akzeptiere jedes „Nein“ und jede Abwehrreaktion – nimm das Kind in seinen Äußerungen und Signalen ernst. Damit leistest Du einen wichtigen Beitrag zu Prävention.
Spieglein, Spieglein…die Ich-Identität
Eine wichtige Grundausstattung für die Kinderbetreuung, um die Körperwahrnehmung und Entwicklung der Ich-Identität zu unterstützen sind Spiegel, möglichst so groß, dass das Kind seinen ganzen Körper darin sehen kann und so einen realen Eindruck von sich selbst gewinnt. Spiegel helfen dem Kind, eine Vorstellung von seinem Aussehen zu entwickeln, da es nur hier z. B. das eigene Gesicht und den Rücken überhaupt sehen und Mimik und Gestik erproben kann. Dabei verknüpft es automatisch die bereits gesammelte taktile Erfahrungen mit den visuellen Eindrücken. Im Alter von etwa 18 Monaten kann ein Kind sich schließlich auch selbst im Spiegel erkennen und als Person wahrnehmen.
Ausscheidungsautonomie als zentrales Thema
Ab einem Alter von etwa zwei Jahren stellt die Entwicklung der Ausscheidungsautonomie ein zentrales Thema im Zusammenhang mit der Körperwahrnehmung dar. Dafür ist neben der biologischen Reife eine gute Kenntnis des eigenen Körpers erforderlich, um die Körperfunktionen steuern und kontrollieren zu können. Gerade in dieser Phase braucht das Kind einfühlsame Erwachsene, die ihm Zeit und Raum geben, die neu gewonnene Unabhängigkeit in der für das Kind wichtigen Intimität ausprobieren und „perfektionieren“ zu können. Ein gut geführter Dialog zwischen Fachkraft und Kind ist in diesem Entwicklungsprozess von großer Bedeutung. Frag das Kind ob und von wem es begleitet werden möchte. Lass ihm die Entscheidung. Mach keine Vorwürfe, wenn es mal daneben geht.
Nein-Sagen erwünscht
Ein weiteres wichtiges Entwicklungsthema im dritten Lebensjahr ist schließlich die Ausbildung der Ich-Identität. In der Autonomiephase erprobt das Kind, was es mit seinem Willen bewirken kann, und erprobt so seine Möglichkeiten und Grenzen. Hier bekommt das Nein – Sagen eine zentrale Bedeutung. Im Kinderschutz und in der Prävention nimmt gerade dieses Nein eine wesentliche Rolle ein. Unser pädagogisches Ziel sind in der Regel Kinder, die wissen, was sie können, die wissen, was sie wollen, die sich abgrenzen können… selbstbewusste, kompetente Persönlichkeiten, die gewappnet für die Herausforderungen des Lebens sind.
Ronny und die Morgenkreiskiste
Um nun in projektorientierter Form, den eigenen Körper entdecken und erforschen zu können, kommt Ronny mit seiner Morgenkreiskiste ins Spiel.
Ronny (s.Beitragsbild) ist eine Handpuppe, die mit allen menschlichen Gliedmaßen und Körperteilen ausgestattet ist. Ronny lebt und schläft in einer Kiste. Bei der Kiste handelt es sich in Anlehnung an die Idee der Morgenkreiskisten von Mariele Diekhoff um eine schön gestaltete Kiste, die unterschiedliche Spielmaterialien und Anregungen rund um das Thema Körper und Körperwahrnehmung enthält und nach einem ritualisierten Ablauf regelmäßig im Spielkreis zum Einsatz kommt. Die Morgenkreiskiste ist aus der Praxiserfahrung heraus bereits ab einem Alter von etwa 18 Monaten geeignet.
Gestaltung der Kiste:
Ein stabiler Pappkarton mit Deckel (mind. 40 x 40 x50 cm) wird außen ansprechend gestaltet, zusätzlich kannst Du die Innenseite mit Spiegelfolie ausgekleiden, dann ist dieser wiederum für weitere Aktivitäten z.B. zum Grimassen schneiden und Gesichtsausdrücke üben einsetzbar.
Möglicher Inhalt:
In die Kiste kommt eine Grundausstattung an Materialien z. B. Bildkarten, Chiffontücher, verschiedene Bälle und Pinsel, Federn, Watte. Für die übersichtliche Aufbewahrung der Materialien sind Stoffsäckchen oder kleinere, verzierte Pappschachteln geeignet. Die Materialien sollten immer in ausreichender Anzahl vorhanden sein. Für geplante Bewegungen mit Musik oder Entspannungen empfiehlt es sich, eine CD mit geeigneter Musik in der Kiste zu deponieren.
Und natürlich darf die Handpuppe nicht fehlen. Vielleicht bekommt diese auch noch ein Schnuffeltuch oder ein Lieblingskopfkissen, damit sie gemütlicher schlafen kann. Was auch noch dazugehört, ist die Spieluhr.
Durchführung:
Einstieg
Setz Dich mit den Kindern in einen Kreis und stell die Kiste in die Kreismitte. Überlege mit den Kindern, wie die Handpuppe geweckt werden könnte. Dann darf ein Kind ganz vorsichtig die Kiste öffnen.
Die Handpuppe begrüßt dann alle Kinder persönlich mit möglichst immer wiederkehrenden Worten. Erfahrungsgemäß möchten viele Kinder die Handpuppe gerne berühren und streicheln.
Mein Ronny ist da jedoch immer sehr klar und bestimmt. Er weiß ganz genau, was er mag und was er nicht mag. Das erklärt er den Kindern und kommt mit ihnen darüber ins Gespräch, was ihnen angenehm ist und was sie nicht mögen. Es gibt auch Tage, da mag er gar keinen Körperkontakt. Genauso spannend ist es auch, wie sich Ronny jeden Tag so fühlt. Mal ist er richtig fröhlich und unternehmungslustig und manchmal ist er auch ganz fürchterlich traurig oder wütend.
Du hast also in dieser Anfangsrunde viele Möglichkeiten, mit den Kindern über die Handpuppe ins Gespräch zu kommen. Ronny kann auch wundervoll zuhören und trösten, wenn ein Kind einmal Trost braucht.
Hauptteil
In diesem Hauptteil kündigt die Handpuppe dann ein Spiel oder Material an, das sie den Kindern mitgebracht hat. Sie „übergibt“ die Durchführung an die Fachkraft und zieht sich auf einen Beobachtungsposten zurück. Ideen und Anregungen rund um die Themen Körper und Sinne findest Du in meinen beiden Büchern: Mein Körper und Meine Sinne, die im Hase und Igel Verlag erschienen sind. Je nach Alter, Interesse und Ausdauer der Kinder kann diese Phase etwa zehn bis 15 Minuten dauern.
Ausklang
Die Handpuppe wendet sich nach dem Hauptteil wieder an die Kinder. Sie erzählt, was sie beobachtet hat und spricht noch einmal mit den Kinder. Auch hier besteht je nachdem nocheinmal die Gelegenheit über die aktuellen Gefühle zu sprechen. Bei der Verabschiedung können erneut einzelne Körperteile wie z. B. Winken mit den Füßen, Klatschen mit den Händen etc. zum Einsatz kommen. Die Handpuppe krabbelt dann müde in die Kiste zurück. Die Spieluhr wird aufgezogen und zu ihm gelegt. Ein Kind schließt vorsichtig den Deckel und alle lauschen bis die Spieluhr verklungen ist. Manchmal, wenn die Kinder ganz besonders gut hinhören, dann hört man Ronny leise schnarchen.
Viel Spaß bei der Umsetzung
Deine Anja
von Anja Cantzler | 10.05.2021 | Allgemein
Seit 2012 findet immer an dem Montag nach Muttertag der Tag der Kinderbetreuung statt. Dieses Jahr fällt dieser Tag auf den 10. Mai und ich möchte den heutigen Tag dazu nutzen, Dir und Deinen Kolleg*innen einfach einmal Danke für die wichtige und wertvolle Arbeit zu sagen, die Du* Ihr tagein und tagaus leistet.
Ein Jahr voller Herausforderungen
Im März des letzten Jahres begann der 1. Lockdown und wir befanden uns alle von heute auf morgen im Schockzustand. Du und Deine Kolleg*innen mussten auf einmal ganz neu denken und Eure Arbeit komplett umstellen. In vielen Kinderbetreuungsstellen waren zunächst nur sehr wenige Kinder zu betreuen und viele pädagogische Fachkräfte wurden ins Home Office geschickt. Endlich war einmal Zeit, viel Liegengebliebenes aufzuarbeiten. Gleichzeitig wurde versucht, irgendwie den Kontakt zu Kindern, Eltern und Kolleg*innen aufrecht zu erhalten. Es entstanden viele gute Ideen und Projekte – und wieder einmal zeigten Pädagogische Fachkräfte ihre Felexibilität und Kreativität, sich den Herausforderungen zu stellen.
Zurück in die Zukunft
So überschrieb ich im letzen Sommer einen Blogbeitrag als die Kinderbetreuung vor gut einem Jahr dann in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren durfte. Wir alle wähnten uns bereits in einer gewissen Sicherheit, dass diese Pandemie nun bald ein Ende nehmen würde. Natürlich gab es viel zu berücksichtigen und zu bedenken, aber das Gröbste schien überstanden zu sein. Auch in dieser Phase haben die Mitarbeitenden in Krippe, Kita und Kindertagespfelege versucht das Beste aus der Situation zu machen. Du hast mit Deinen Kolleg*innen die Kinder wiedereingewöhnt, Schulkinder verabschiedet und neue Kinder in Empfang genommen. Parallel hast Du Dich um Deine eigenen privaten und familiären Belange gekümmert. In dieser Aufzählung klingt das gerade erstaunlich „normal“, aber in der Realität war da mal gar nichts normal. Betreuung in strikt getrennten Gruppen, Betretungsverbot für die Eltern, keine Dienstbesprechungen, Einhalten von verschärften Hygienevorschriften, vielerorts Masken tragen …
Dann ein erneuter Rückschritt
Seit Ende letzten Jahres befinden wir uns erneut in der sognenannten Notbetreuung, die vielerorts bei näherer Betrachtung ein Regelbetrieb mit verkürzten Betreuungszeiten ist. Anstatt klarer Vorgaben, welches Kind die „Notbetreuung“ nutzen kann, erfolgt ein Appell an die Eltern, der nach Gutdünken auslegbar ist. Viele pädagogische Fachkräfte fühlen sich schon seit längerem nicht mehr ernst und wahr genommen. Sie stehen mit an vorderster Front und bekommen den Unmut der Eltern geballt und ungefiltert ab. Die pädagogischen Fachkräfte und Eltern befinden sich seit Monaten im Ausnahmezustand und dadurch gerät die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft oftmals auf den Prüfstand. Auch hierzu habe ich bereits mehrere Beiträge in diesem Blog bzw. in meinen KitaTalks auf YouTube veröffentlicht.
Einfach mal Danke sagen
Unter diesen Umständen ist es wirklich nicht leicht, immer wieder gut für sich selbst zu sorgen, um dann Tag für Tag mit neuer Kraft für Kinder und Eltern da zu sein. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle einfach mal Danke sagen.
Ich danke allen pädagogischen Fachkräften, die
- Tag für Tag für die Kinder da sind und ihre Gesundheit riskieren
- die Kinder ohne 1,50m Abstand in den Arm nehmen
- ohne Plexiglasscheibe Tränen trocknen und Nasen putzen
- auf die Gefühle, Sorgen und Ängste der Kinder eingehen
- und eigene Sorgen und Ängste zurückstellen
- ein offenes Ohr für die Nöte der Eltern haben
- die ihre eigenen Kinder von anderen zu Hause betreuen lassen, um zur Arbeit zu kommen
- Dokumentationen im HomeOffice schreiben, während die eigenen Kinder HomeSchooling haben
Ich danke im Speziellen allen Leitungskräften, die
- den Überblick in diesen ständig sich verändernden gesetzlichen Bestimmungen behalten
- die Einhaltung der Hygienevorschriften gewährleisten
- ein offenes Ohr für Ängste und Sorgen haben, obwohl es ihnen oftmals ähnlich geht
- den Dienstplan bei allen Schwierigkeiten von Personalschlüssel und Infektionsrisiko organisieren
- oftmals am Wochenende die Pläne der Regierungen umsetzen mussten
- trotz erschwerter Bedingungen versuchen, die Teams zusammen zu halten
Licht am Ende des Tunnels
Ich hoffe und wünsche von ganzem Herzen, dass wir jetzt wirklich bald das Licht am Ende des Tunnels erreichen. Dann gibt es immernoch viel zu tun und ich bin sehr gespannt, wie die Arbeit in der Kindertagesbetreuung zukünftig aussehen wird. Ich bin jedoch sehr zuversichtlich, dass es auch im kommenden Jahr wieder Vieles geben wird, für das ich Dir und Deinen Kolleg*innen danken kann.
Deine Anja
Hier noch einmal zur Erinnerung die im Text angesprochenen Blogartikel:
Und KitaTalks auf YouTube:
von Anja Cantzler | 6.10.2020 | Team
Seit einigen Wochen befindest Du Dich mit Deinem Team mehr oder weniger wieder im Regelbetrieb und die meisten Kinder sind eingewöhnt. Langsam stellt sich so etwas wie Alltag ein.
Auch ich bin wieder vermehrt als Weiterbildnerin, Coach und Supervisorin unterwegs und begegne verschiedenen Teams vor Ort. Immer wieder merke ich, dass der zurückliegende Lockdown mit Notbetreuung und HomeOffice und die dann schrittweise erfolgte Rückkehr in den Regelbetrieb nicht ganz spurlos an manchen Teams vorüber gegangen ist.
Die zurückliegenden Zeiten, in denen
- nur immer ein Teil des Teams im Wechsel die Notbetreuung übernommen hat
- einige Kolleg*innen noch bis vor kurzem nicht in der Arbeit mit den Kindern eingesetzt waren, weil sie zur Risikogruppe gehörten
- gruppenübergreifende Zusammenarbeit durch die strikte Gruppentrennung nicht möglich war
teilweise erhebliche Auswirkungen auf das Teamgefüge hat.
Erschwerend kommt hinzu, dass durch die Pandemie die Lebenssituation jeder*s Einzelnen persönlich und beruflich auf den Kopf gestellt wurde. Jede*r im Team ist betroffen und die damit verbundenen Verunsicherungen haben komplexe Wechselwirkungen zur Folge. Gemäß der Veränderungskurve nach Kübler-Ross hat Jede*r von uns diese Veränderungen in seinem eigenen Tempo verabeitet. Wir alle hatten mit einer solchen Situation keine Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen könnten. Es mussten neue Kommunikationswege und Leitungsstrategien entwickelt werden.
Träger, Fachberatungen und Leitungskräfte haben sich in dieser Zeit als Krisenmanager*innen unter Beweis stellen und sich immer wieder auf neue Gegebenheiten einlassen müssen. Obwohl in diesen Funktionen und Rollen auch alle Personen persönlich betroffen waren, waren sie als Fels in der Brandung und mit viel Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit gefordert. In dem von mir in dieser Zeit angebotenen Zoom-Autausch mit Fach- und Leitungskräften wurde oftmals deutlich, wie sehr die ganze Situation an den Kräften der Einzelnen gezehrt hat.
Was macht ein gutes Team aus ?
In der Regel zeichnet sich ein gutes Team durch
- ein Wir Gefühl
- gemeinsame Spielregeln
- ressourcenorientierte Zusammenarbeit
- klare Rollenverteilung
- regelmäßige Kommunikation
- gemeinsame Aufgabenbewältigung
- gemeinsame Verantwortlichkeit
- gemeinsame Bewältigung von Konflikten
- soziale Unterstützung in Stresssituationen
aus. Das alles zusammen gibt Halt und ein Gefühl von gemeinsamer Stärke.
Unter der Pandemie ist vieles anders
Diese wesentlichen Grundlagen sind unter der Pandemie in einigen Teams auf eine harte Probe gestellt worden.
Einige Teams sind in den vergangenen Monaten trotzdem verstärkt zusammen gewachsen und zeichnen sich durch
- ein ausgeprägtes Wir-Gefühl
- viel Flexibilität
- Kreativität im Umgang mit den Rahmenbedingungen
- Lösungsorientierung
- Optimismus
aus.
In anderen Teams haben die Geschehnisse der letzten Monate zur Folge, dass:
- die Konzentration auf die Arbeit in den Gruppen die gruppenübergreifende Zusammenarbeit blockiert
- der Verzicht auf Gesamtdienstbesprechungen die Kommunikationswege massiv verändert
- fehlende konzeptionelle Absprachen dazu führen, dass in den Gruppen unterschiedlich gearbeitet wird.
Diese Teams haben sich zunehmend auseinander gelebt und drohen auseinander zu brechen.
Teamentwicklung als Schlüssel
In allen Teams sollte in den nächsten Monaten Teamentwicklung im Vordergrund stehen. Nimm Dir Zeit mit Deinem Team, damit Ihr Euch als Team mit Blick auf das Zurückliegende reflektiert, zusammen die gegenwärtige Arbeit gestaltet und gemeinsam auf Ziele und Visionen hinarbeitet. Dabei sind gemeinsam die zurückliegenden Veränderungen zu reflektieren und aufzuarbeiten. Überlege gemeinsam mit Deinem Team, was im Einzelnen neu dazugekommen ist, was Ihr von Eurer pädagogischen Arbeit bewahren konntet und wovon Ihr Euch im Moment verabschieden müsst.
Überleg gemeinsam mit Deinem Team, was Ihr in den letzten Monaten erreicht und geschafft habt:
- Was ist Euch gelungen? Was habt Ihr gemeinsam gemeistert? Worauf könnt Ihr stolz sein?
- Welche Kompetenzen und Ressourcen der Einzelnen haben zum Gelingen beigetragen?
- Mit wieviel Flexibilität und Kreativität habt Ihr Lösungen entwickelt?
- Welche Stärken habt Ihr als Team in dieser Zeit entwickelt?
Sprich mit Deinem Team möglichst offen über Bedenken, Sorgen und Ängste. Oftmals ist es hilfreich, über die eigenen Emotionen sprechen zu können. Wichtig ist, dass jede Emotion ihre Berechtigung hat. Begegnet Euch mit viel Achtsamkeit und Wertschätzung.
Konzentrier Dich mit Deinem Team auf Eure Gemeinsamkeiten und erarbeitet, was Euch in der gemeinsamen Arbeit verbindet und ausmacht. Entwickelt gemeinsame Ziele und Visionen.
Und zu guter Letzt: vergiss den Humor nicht! Gemeinsames Lachen hat eine entspannende und verbindende Wirkung. Es hilft eine notwendige Distanz zu den Geschehnissen herzustellen, um auch die nächsten Wochen und Monaten bevorstehende Herausforderungen gut zu meistern.
Hol Dir Unterstützung
Wenn Du merkst, dass Du und Dein Team Begleitung und Unterstützung in diesem Teamprozess brauchen, dann wende Dich an eine*n Coach oder Supervisor*in. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich an Träger und Fachberatungen appelieren, dies zu unterstützen, um langfristig die Gesundheit und Arbeitszufriedenheit in den Teams zu gewährleisten.
Zur Erinnerung
Denk daran: Ein gutes Team ist mehr als die Summe seiner Mitglieder. Schaut nach vorne und mach Dich gemeinsam mit Deinen Kolleg*innen auf den Weg. Gemeinsam seid Ihr stark!
Deine Anja
Fortbildungstipp: Online – Seminar für Leitungskräfte
Neues entsteht – Teamprozesse in Zeiten „nach“ Corona wahrnehmen und begleiten
Donnerstag, den 27.05.2021 von (15.30) 16.00-19.00 Uhr
von Anja Cantzler | 8.09.2020 | Bindung und Eingewöhnung
Die meisten Krippen, Kitas und Kindertagespflegestellen sind gerade mitten in der Eingewöhnungszeit. Wie in dem Blogbeitrag: „Viele Modelle- ein Ziel“ bereits beschrieben, wird in den verschiedenen Einrichtungen mit unterschiedlichen Ansätzen eingewöhnt. Alle Eingewöhnungsmodelle haben folgende Ziele: „das Kind soll sich in der Betreuung emotinal wohlfühlen, gerne kommen und die Pädagogischen Fachkräfte als stressregulierende Bezugspersonen annehmen.“
Doch bis Du mit dem einzelnen Kind dort hinkommst, liegt ein langer und oftmals auch tränenreicher Weg vor Dir, dem Kind und seinen Eltern. Mal Hand aufs Herz, wünscht du Dir in diesen Tagen auch manchmal insgeheim, dass die Eingewöhnungszeit dieses Mal ohne Tränen abläuft? Ein Jahr, dass alle Kinder von Anfang an gerne kommen und nicht weinen müssen? Doch aus Erfahrung weißt, dass dies nicht so sein wird.
Deswegen möchte ich in diesem Blogbeitrag zum einen klären, warum Tränen so wichtig für die Kinder sind und wie Du damit kind- und bedürfnisorientiert umgehen kannst. Zum anderen möchte ich Dich auf die möglichen Fehlanzeichen aufmerksam machen, an denen pädagogische Fachkräfte oftmals fälschlicherweise festmachen, dass die Eingewöhnung für das Kind bereits abgeschlossen ist.
Die Bedeutung der Tränen
Durch das Weinen drücken die Kinder ihre Trauer über die Abwesenheit der Eltern aus. Sie sind Ausdruck des emotionalen Befindens und kindlichen Bedürfnisse. Für viele Eltern ist das sehr schmerzhaft, wenn ihr Kind weint und sie versuchen, diese Tränen zu vermeiden. Wichtig ist, dass Du mit den Eltern über die positive Bedeutsamkeit der Tränen sprichst. Es ist wünschenswert, dass ein Kind in der Lage ist seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ich vermittel daher den Eltern immer auf Elternabenden und in Elternberatungen, dass dies ein ganz natürliches und gesundes Verhalten des Kindes ist und dass das Kind ein Recht auf seine Trauer hat.
Die Eingewöhnung stellt große Herausforderungen an das Kind und sind daher für die Kinder mit einem erhöhten Stresspegel verbunden. Die Tränen unterstützen das Kind während des Eingewöhnungsprozesses, Anspannung und Stress abzubauen.
Tränen gehören also durchaus zu einer gelingenden Eingewöhnung. Es geht nicht darum sie zu vermeiden oder zu unterdrücken, es geht vielmehr darum, diese Tränen gemeinsam mit den Eltern achtsam und feinfühlig zu begleiten.
Die Dont’s im Umgang mit Tränen
Bitte vermeide deswegen dem Kind gegenüber Sätze wie:
- „Du musst nicht traurig sein“ – damit verleugnest Du das Gefühl des Kindes. Das Kind ist in diesem Augenblick jedoch sehr traurig und fühlt diese Emotion. Besser wäre, ihm für seine Trauer Worte zu geben: „Du bist jetzt sehr traurig, dass Mama gegangen ist.“
- „Schau mal was ich hier habe…“ – wird gerne als Ablenkungsmanöver genutzt. Auch das ist nicht sehr ratsam, da das Kind indirekt die Botschaft erhält, dass seine Gefühle nicht wichtig sind. Es soll die bestehenden Gefühle zurückstellen und unterdrücken. Es erhält keine Chance die eigenen Emotionen zu regulieren, was wiederum ein wichtiger Meilenstein in der emotionalen Entwicklung und der Resillienzförderung ist.
- „Nimm deinen Schnuller, trink oder iss etwas…“ – damit lernt das Kind fälschlicherweise heftige Emotionen mit Hilfe von Essen und Trinken zu kompensieren. Dieses Verhalten kann den ersten Grundstein für ein gestörtes Essverhalten und Süchte legen.
Tränen achtsam begleiten
Was kannst Du also tun, um ein Kind achtam und feinfühlig durch die Eingewöhnungszeit zu begleiten?
- Signalisiere dem Kind Verständnis für seine Trauer, sag ihm: „Ich verstehe, dass Du traurig bist!“
- Vermittel dem Kind, dass Du ihm vertraust, dass es früher oder später diesen Entwicklungsschritt schaffen wird.
- Gib dem Kind Worte für seine Gefühle. Damit zeigst Du ihm, dass Du diese Gefühle wahrnimmst und diese Gefühle sein dürfen.
- Sprich mit dem Kind über seine Gefühle.
- Vermeide dem Kind gegenüber Bedauern über seine Trauer zu äußern. Es geht in erster Linie um Mitgefühl und nicht um Mitleid.
- Selbsreflexion als Basis für Empathie
Selbsreflexion als Basis für Empathie
Überprüf Deine eigenen Gefühle und Haltung bezüglich der Eingewöhnung. Gerade wenn die Kinder noch sehr jung sind, solltest Du Dich reflektieren, inwieweit Du es als richtig und wichtig empfindest, dass dieses Kind schon in einer Kindertagesbetreuung betreut wird. Kannst Du die Entscheidung der Eltern wertfrei stehen lassen? Oder bist Du der Meinung, dass das Kind zu Hause viel besser aufgehoben wäre?
Deine eigene Haltung überträgt sich auch immer auf Dein pädagogisches Handeln. Bist Du der Überzeugung, dass das Kind zu Hause besser aufgehoben wäre, dann wirst Du die Tränen des Kindes vermutlich unter diesem Blickwinkel betrachten. In diesem Fall ist der Schritt vom Mitgefühl zum Mitleid für das Kind nur noch ein ganz kleiner. Unbewusst läufst Du Gefahr, dem Kind mit dieser Haltung den Einstieg zu erschweren. Nicht nur Eltern, denen es schwer fällt loszulassen, übertragen ihre Gefühle auf das Kind. Auch Du als pädagogische Fachkraft sendest nonverbal Haltung und damit verbundene Erwartungen an das Kind.
Bis du also der Überzeugung, dass das Kind bei Dir gut aufgehoben ist und dass es diese Herausforderung aktiv und kompetent meistern wird, wirst Du mit den Tränen des Kindes ganz anders umgehen können und das Kind wird sich gemäß dieser Erwartungen anders verhalten.
Mögliche Fehlinterpretationen im Eingewöhnungsprozess
So unterschiedlich die Kinder und Familien sind, so unterschiedlich verlaufen die verschiedenen Eingewöhnungsprozesse. In Deiner Praxis begegnen Dir neben den weinenden Kindern einzelne, bei denen tatsächlich keine Tränen auftreten oder die Tränen sehr schnell verschwunden sind. In diesen Fällen besteht dann die Gefahr der Fehleinschätzung, dass das Kind bereits gut angekommen und damit die Eingewöhnung abgeschlossen ist.
Hier ein paar Beispiele:
- ein Kind spielt ununterbrochen und begibt sich neugierig auf Entdeckungstour. Es ist sehr beschäftigt mit dem neuen Raum, den neuen Spielmaterial und den neuen Kindern. Durch den Reiz des Neuen bleibt ihm zunächst keine Zeit für Trauergefühle. Es trennt sich gut und unproblematisch von den Eltern. Der Einbruch kommt dann oftmals nach 6-8 Wochen, wenn der Reiz des Neuen aufgebraucht ist. Jetzt tritt erstmals Langeweile auf und die Trauer um die Eltern setzt ein. Das Kind wird traurig, weinerlich und manchmal auch aggressiv. Es zeigt jetzt seine Emotionen in voller Bandbreite. Trau dich die Eltern zu bitten, vorübergehend einen Moment länger zu bleiben und die Traurigkeit des Kindes entsprechend zu begleiten.
- Kinder, die von der Persönlichkeit her offen, zugänglich und kommunikativ sind, werden manchmal überfordert und verschätzt. Durch ihre fröhliche und aufgeschlossene Art wird die Vermutung aufgestellt, dass die Eingewöhnung ganz schnell und unkompliziert stattfinden wird. Dadurch wird der Eingewöhnungsprozess dann gerne verkürzt, was bei manchen dieser Kinder dazu führt, dass sie dann bei längerer Abwesenheit der Eltern auf einmal viel gehemmter und zurückhaltender werden. Lass Dich also nicht von einem solchen Verhalten auf die falsche Fährte führen. Der Gradmesser ist immer das beobachtbare Spielverhalten, sobald die Eltern länger abwesend sind.
- bei einem anderen Kind, dass zunächst unbekümmer mit der neuen Situation umgeht und dadurch die Trennung von den Eltern vorzeitig herbeigeführt wird, kann die Trauerphase auch erst zeitverzögert einsetzen. Ähnlich der Veränderungskurve nach Kübler-Ross, kommt das Kind nach dem ersten Schock und der Verdrängung der Realität in das Tal der Tränen. Auch hier darfst Du den Mut haben, die Eltern noch einmal zurück und den verpassten Loslösungsprozess nachzuholen.
- eine weitere typische Situation ist, wenn ein Kind bei der Verabschiedung zwar weint, sich dann schnell wieder beruhigt, sobald die Eltern weg sind. In diesem Fall solltest Du das Kind gut beobachten, ob es dann wirklich fröhlich spielen geht. Manche Kinder legen dann ein lethargisches Verhalten an den Tag, haben permanent gerötete Augen, jammern still vor sich hin, werden anhänglich oder zeigen vielfältige Krankheitssymptome. Das alles sind ernstzunehmende Stresssymptome. In einem solchen Fall sind, wenn möglich die Eltern wieder mit ins Boot zu holen. Trau Dich, zum Wohle des Kindes mit Eltern zu besprechen, was möglich ist oder ob es eine andere Bindungsperson gibt, die das Kind noch begleiten kann. Ist dies seitens der Eltern nicht machbar, dann brauchen diese Kinder Dich als verlässliche Bezugsperson, die bereit ist, dem Kind viel Nähe und möglichst auch Körperkontakt anzubieten.
- schließlich gibt es auch noch die Kinder, die vermeiden ihre negativen Gefühle in einer Trennungssituation zu zeigen. Sie reagieren nicht, wenn die Eltern gehen und sie zeigen auch keine freudige Raktion, wenn die Eltern wiederkommen. Während der Abwesenheit der Eltern nehmen sie selten Kontakt zu den pädagogischen Fachkräften auf. Auch wenn sie in der Eingewöhnung recht unbeeindruckt wirken, stehen diese Kinder unter einem sehr hohen Stresspegel. Sie bedürfen der besonderen Aufmerksamkeit und Ansprache, da sie erst lernen müssen, dass jemand ihre Gefühle wahr und ernst nimmt. Begleite die Kinder sprachlich. Benenne ihre Gefühle und signalisiere, dass Du für sie da bist.
Soweit die vielen kleinen Nuancen, die im Eingewöhnungsprozess zu beachten sind. Selbstverständlich gibt es auch Kinder, die ganz unkompliziert und schnell in der Kindertagesbetreuung ankommen. Kinder, die ihren Eltern beispielsweise vermitteln, dass das ein Kinder- und kein Elterngarten ist. Dies zeugt von positiven Vorerfahrungen mit der Trennung von den Eltern. Andere kulturelle Wurzeln und Kontexten, in denen nicht der Erwachsene die Bindungsperson Nr.1 für das Kind ist, sondern andere Kinder diese Rolle übernehmen, kann andererseits dafür ursächlich sein, dass diese Kinder schnell Anschluss an die Kindergruppe finden und sich wohl fühlen. Die Peer Group gibt dem Kind viel Halt und Sicherheit. (vgl. Kultursensitive Pädagogik nach Heidi Keller).
Die Bedeutsamkeit der PeerGroup
Aus der besonderen Bedeutung und Wirkung der Kindergemeinschaft für den Eingewöhnungsprozess hat sich die Eingewöhnung in der Peer Group entwickelt. Die Kinder unterstützen sich in dieser herausfordernden Situation gegenseitig und erfahren, dass sie mit ihren Gefühlen nicht alleine sind. Sie lernen von und miteinander diese Übergangssituation zu meistern. Ein interessantes Modell, auf das ich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal genauer eingehen werde.
Ich wünsche Dir noch eine gute und gelingende Eingewöhnungszeit- je nach Kind und Familie mit und ohne Tränen
Deine Anja
Ein Fortbildungstipp
Safe the Date! – Wenn Du mehr über die Eingewöhnung in der Peer Group erfahren willst. Am Samstag, 23.01.2021 von 9.30-12.00 Uhr biete ich wieder in Kooperation mit Haus Neuland eine Online- Seminar hierzu an.
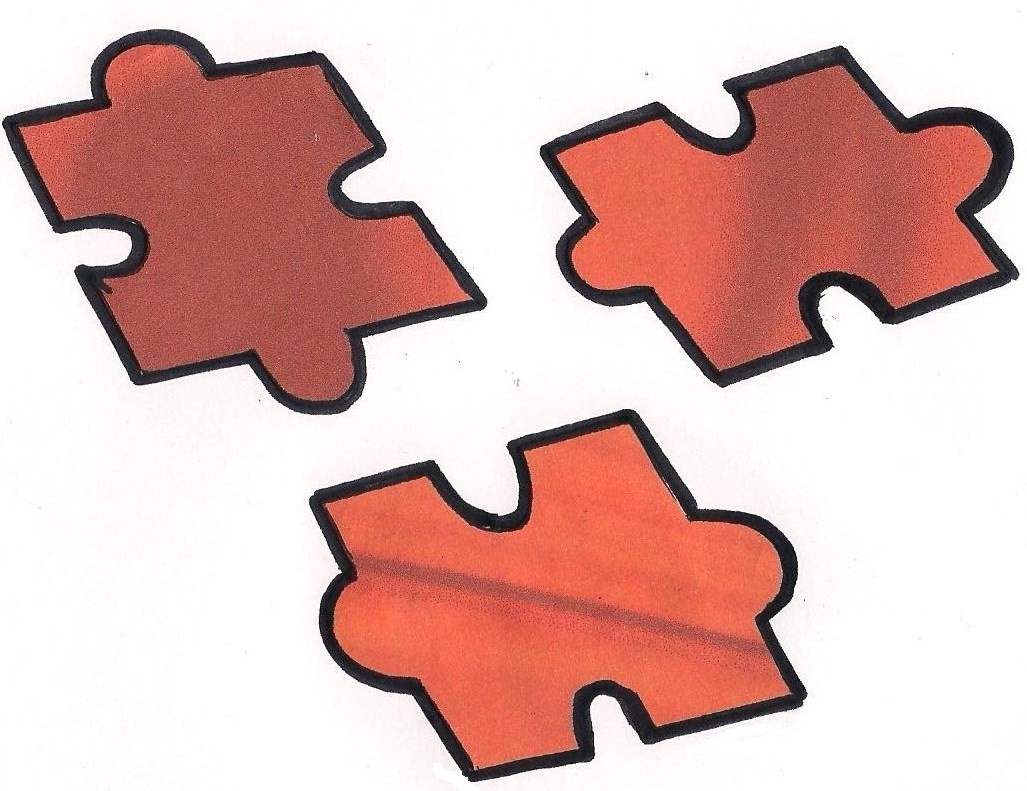
Neueste Kommentare