Die Magie der Eingewöhnung – Bewährte und Neue Materialien für Krippe, Kita und Kindertagespflege
Hier in NRW enden diese Woche die Schulferien und die ersten Eingewöhnungen sind bereits im vollen Gange.
Aufnahme und Eingewöhnung von neuen Kindern und ihren Familien sind immer wiederkehrende Themen in Krippe, Kita und Kindertagespflege. Die Eingewöhnung ist die Basis für alles weitere: zum einen mit Blick auf die Entwicklung des Kindes und zum anderen mit Blick auf die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Eine Eingewöhnung ist in der Regel nicht nach zwei bis drei Wochen abgeschlossen, je nach Kind dauert sie auch gerne länger. Meines Erachtens ist dabei wichtig nicht an einem Modell starr zu kleben, sondern diesen Übergang möglichst individuell und bedürfnisorientiert zu gestalten und zu begleiten.
Bereits 2021 habe ich einen ähnlichen Blogartikel veröffentlicht, den ich hiermit aktualisieren und ergänzen möchte, da seither viele neue Beiträge, Materialien und Bücher von meinen Kolleg*innen und mir erschienen sind.
Vorab möchte ich dir meine 5 Tipps zur Eingewöhnung ans Herz legen. Hierbei handelt es sich um einen mehrteiligen E-Mail Kurs, mit dessen Hilfe du über eine Woche hinweg eure Eingewöhnung reflektieren und überprüfen kannst. Vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Anregungen, um im kommenden Jahr, die Gestaltung des Übergangs zu verändern.
Eingewöhnung, Ankommenszeit, Beziehungszeit…
Zunächst einmal ein paar kurze Gedanken zum Begriff „Eingewöhnung“. Ich bin schon seit einigen Jahren nicht mehr glücklich mit dem Begriff „Eingewöhnung“. Er hat zum einen etwas sehr passives: „die Kinder und ihre Familien“ werden eingewöhnt. Dabei sollten sie doch zu jedem Zeitpunkt aktiv am Prozess beteiligt sein. Sie bestimmen Tempo und Vorgehen je nach Bedürfnis mit. Zum anderen sollte es nicht darum gehen, dass sich irgendwer an irgendetwas „gewöhnen“ muss. Geht es nicht in erster Linie um den Beziehungsaufbau? Nicht Gewöhnung sondern sich miteinander vertraut machen und zueinander Vertrauen aufbauen, darum sollte es gehen. Im besten Fall gelingen Übergang und Beziehungsaufbau so, dass die Kinder gerne und mit Freude zu dir in die Krippe, Kita und Kindertagespflege kommen.
Deswegen würde ich mich gerne langfristig von dem Begriff der Eingewöhnung verabschieden. Ankommens- und Kennenlernzeit sind für mich viel stimmigere Begrifflichkeiten.
Meine Motivation
Warum ist mir das Thema so wichtig? Meine Erfahrungswissen reicht nun gut 30 Jahre zurück und als junge Fachkraft im Berufspraktikum habe ich noch miterlebt, was es hieß keinen gut begleiteten Übergang für Kinder und ihre Familien zu gestalten.
Mein erster Arbeitstag war die Hölle. Die mir fremden Kinder wurden gebracht und mussten umgehend bis zu 4 Stunden ohne Eltern in meiner Gruppe bleiben. Uns ging es allen unglaublich schlecht damit: viele Kinder haben gelitten- leise oder laut, je nach Persönlichkeit und Vorerfahrung. Die Eltern mussten gehen und waren buchstäblich unerwünscht- bloss nicht zu lange bleiben, das Kind könnte sich ja daran gewöhnen. Und ich war mega gestresst und abends fix und fertig.
Ich spürte sehr früh, dass da etwas gehörig falsch lief.
In den drei Folgejahren baute ich nach und nach 3 neue Kitas mit auf – erst als Fachkraft, später als Leitung. Die jüngsten Kinder waren 4-6 Monate alt. Uns war schnell klar, dass da die Eltern mit ins Boot geholt werden müssen, damit die Kinder sanft und sicher bei uns ankommen können.
Wir machten gute Erfahrungen und gut 12 Jahre nach meinem Berufseinstieg war mir als Weiterbildnerin klar, was ich für Kinder im Übergang von der Familie in die Kita möchte. Ich lernte das Berliner Eingewöhnungsmodell kennen und kämpfte gegen viele Windmühlen, um eine elternbegleitete und bezugspersonenorientierte Eingewöhnung als Standard für Kitas mit einzuführen.
Seither begleitet mich dieses Thema und lässt mich nicht mehr los. Auch wenn ich seit einigen Jahren mich intensiver mit der PeergroupEingewöhnung beschäftigt habe und darüber referiere- mein Herz hängt seit eh und je an einer an den Bedürfnissen des Kindes und seiner Familie orientierten Ankommenszeit. Aus meiner Sicht ist jede Familie individuell zu betrachten und zu begleiten.
Gesammelte Blogartikel
Auf diesem Wissen- und Erfahrungshintergrund sind in den letzten drei Jahren hier viele Blogartikel für die Begleitung der Kinder und Familien von zu Hause in die Kita entstanden. Zur besseren Übersicht findest du hier eine Aufstellung der verschiedenen Beiträge (mit einem einfachen Klick auf den Link gelangst du zu den einzelnen Artikeln) :
- Die Eingewöhnung – Verschiedene Modelle, ein Ziel
- bietet eine kurze Übersicht über die verschiedenen Modelle
- Eingewöhnung im Beziehungsdreieck
- benennt die stillen Fragen des Anfangs
- „Kuschel muss mit“ – Übergangsobjekte in der Eingewöhnung
- erörtert die Bedeutung von Übergangsobjekten für Kinder
- Ein sicherer Platz für Kuschel&Co – Die Ich Box
- stellt eine Methode für die Aufbewahrung der Übergangsobjekte vor (Gastbeitrag von Mareike Paic
- Abschied ohne Tränen
- erläutert die Stolperfallen im Eingewöhnungsprozess, wenn die Eingewöhnung vermeintlich schnell und einfach stattfindet
- Wenn Loslassen schwer fällt
- beschreibt die Perspektive der Eltern und ihren guten Gründen
- Die Möglichkeiten der Marte Meo Methode in der Eingewöhnung
- Monika und Kathrin vom Krüger&Thiel Institut stellen hier praxisnah und anschaulich dar, wie der Beziehungsaufbau durch Marte Meo gestützt wird
- Schluss mit Mythen und Irrtümern in der Eingewöhnung
- es gibt soviele Fehlannahmen rund über die Eingewöhnung, damit räumt dieser Blogartikel auf
- Bindungsstärkendes Spielen in der Eingewöhnung
- ein Gastbeitrag von Gundula Göbel über die Bedeutung des Spiels beim Bindungsaufbau
- Eingewöhnung als Teamaufgabe
- es geht immer daraum, ein Konzept gemeinsam zu entwickeln und umzusetzen
- Kleine Zeichen, große Bedeutung
- von der Kunst gerade in der Eingewöhnung die Signale der Kinder richtig zu deuten
Bücher, Blogartikel und mehr speziell zur Peergroup-Eingewöhnung
Bereits im November 2023 ist mein Buch zur Peergroup Eingewöhnung im Verlag an der Ruhr erschienen. Das Buch erläutert die theoretischen Grundgedanken und stellt dar, welche Bedeutung die Gruppe der Gleichaltrigen für die kindliche Entwicklung hat. Mein Fokus lliegt dabei auf der praktischen Umsetzung des Modells. Hier kommst du direkt zur Bestellung.
Um dich schon einmal ins Thema einzuschwingen, habe ich dir hier ein paar Blogartikel zusammengestellt:
- Eingewöhnung in der Peergroup
- eine erste Einführung in dieses alternative Modell
- Peergroup Eingewöhnung – ein Erfahrungsbericht aus der Kindertagespflege
- eine Tagesmutter berichtet über ihre Erfahrungen
- Peergroup Eingewöhnung – Stimmen aus der Praxis
- in diesem Beitrag erzählen Leitung, Mitarbeitende und ein Elternteil über ihre Erfahrungen in der Praxis
Mittlerweile war ich schon in einigen Podcasts zu dem Thema als Expertin eingeladen:
- Feas Naive Welt: Eingewöhnung in der Peergroup
- Kindertagespflege-Podcast: #14 Peergroup Eingewöhnung
Bei meinen KitaTalks begegnet dir die Peergroup auch gleich zweimal:
- Peergroup Eingewöhnung in der Kita mit Christa Manske
- Eingewöhnung in der Peergroup mit Sabrina Djogo
Wenn du ergänzend zu diesen Infos an einem Seminar zu diesem Thema interessiert bist, gibt es im Herbst 2023 und im Frühjahr 2024 wieder verschiedene Live-Online Seminare im Haus Neuland, Kath. Landvolkshochschule Hardehausen und VHS Hannover Land. Auf Anfrage biete ich auch Online Seminare für Teams an.
Meine KitaTalks
Es gibt auch noch einige Folgen der Kita Talks zum Thema Eingewöhnung, wo es um die bedürfnisorientierte Eingewöhnung, die Eingewöhnung von Kindern mit und ohne Fluchterfahrung und der kultursensiblen Eingewöhnung geht. Zum Stöbern in den KitaTalks klickst du am besten HIER.
Beliebte andere Podcasts
- #2 Eingewöhnung mit (Kleinst-)kindern gestalten von Kathrin Hohmann/ kindheit erleben
- #26 5 Tipps für eine gelungene Eingewöhnung von Fea Finger/ Feas naive Welt
- 26 Bedürfnisorientierte Eingewöhnung mit Stefanie von Brück – Teil 1/ DerKitaPodcast von Lea Wedewardt
- 27 Bedürfnisorientierte Eingewöhnung mit Stefanie von Brück – Teil 2/ DerKitaPocast von Lea Wedewardt
Weitere Bücher und Materialien
Gerade ganz neu erschienen ist das sehr empfehlenswerte Buch von Lea Wedewardt: Ankommen dürfen statt Loslassen müssen. Hier wird aus vielen Blickwinkeln beschrieben, wie eine Bedürfnisorientierte Eingewöhnung in der Praxis gelingen kann. Hier erfährst du mehr und kommst direkt zur Bestellung.
Eine weitere sehr empfehlenswerte Neuerscheinung ist das Praxisbuch zur Eingewöhnung vom Krüger&Thiel Institut. Das Buch bietet eine Fülle von Ideen und Anregungen für Eltern und Fachkräfte. Es gibt Orientierung, wie die Eingewöhnungsphase gestaltet werden kann, damit Kinder, Eltern und Fachkräfte einen gelingenden, gemeinsamen Start in die Kitazeit bekommen können.
Das Krüger & Thiel Institut hat außerdem eine kleine Broschüre mit dem Titel: Sanfte Eingewöhnung für mein Kind veröffentlicht. Die Broschüre bestehen aus liebevoll zusammengestellten Fotos mit Szenen aus dem Eingewöhnungsalltag einer KiTa. Hier wird den Kindern eine Stimme gegeben und somit ihre Sichtweise auf die Eingewöhnung verdeutlicht. Die Erwachsenen bekommen Handlungsanregungen für die Gestaltung und Begleitung des Eingewöhnungsprozesses. Sehr hilfreich und empfehlenswert für die Zusammenarbeit mit Eltern.
Für Kinder in der Eingewöhnung ist beim Krüger&Thiel Institut außerdem ein ganz reizendes kleines Bilderbuch: Mira, Tuffi und die Gefühle erhältlich. Hier begleitet der kleine Stoffelefant Tuffi die kleine Mira in ihrern ersten Kindergartentagen und beschreibt ihre Gefühle. Sehr schön, für die Gruppe oder als kleines Willkommensgeschenk für die neuen Kinder.
Meine geschätze Kollegin Gundula Göbel hat die Broschüre zu ihrem Bindungsbaumkonzept vor Kurzem überarbeitet. Besonders empfehlenswert für die umfassende Auseinandersetzung mit der Gestaltung einer bindungsorientierten Eingewöhnung ist ihre Schulungsbox: Bonding-Bindung-Bildung. Die schön gestaltete A4 Box ist gefüllt mit Bindungswissen. Auf 19 A4 Bildkarten ist jeweils ein Begriff des Bindungsbaumes beschrieben und mit jeweils drei konkreten Fragen zur Vertiefung versehen, auf der anderen Seite der Bildkarte ist ein sprechendes Foto mit passendem Zitat, um einen Impuls für einen Austausch im Team oder mit Eltern zu geben.
Und zu jeder guten Eingewöhnung gehört natürlich auch die Portfolioarbeit. In diesem Rahmen hat Sandra Warsewicz von der Werkstatt der Guten Gedanken sehr schöne Vorlagen entwickelt. s lohnt sich da mal durch ihre Seite zu stöbern.
Da sollte doch was für Jede*n dabei sein. Und selbstverständlich kannst du gerne in Kommentaren weitere Tipps geben, mit welchen Materialien du so in der Praxis arbeitest, um dich mit deinem Team vorzubereiten, Eltern mit ins Boot zu holen und Kinder z.B. durch Bilderbücher den Start zu erleichtern.
Ich wünsche einen guten Start ins Kita Jahr 23/24
Deine Anja
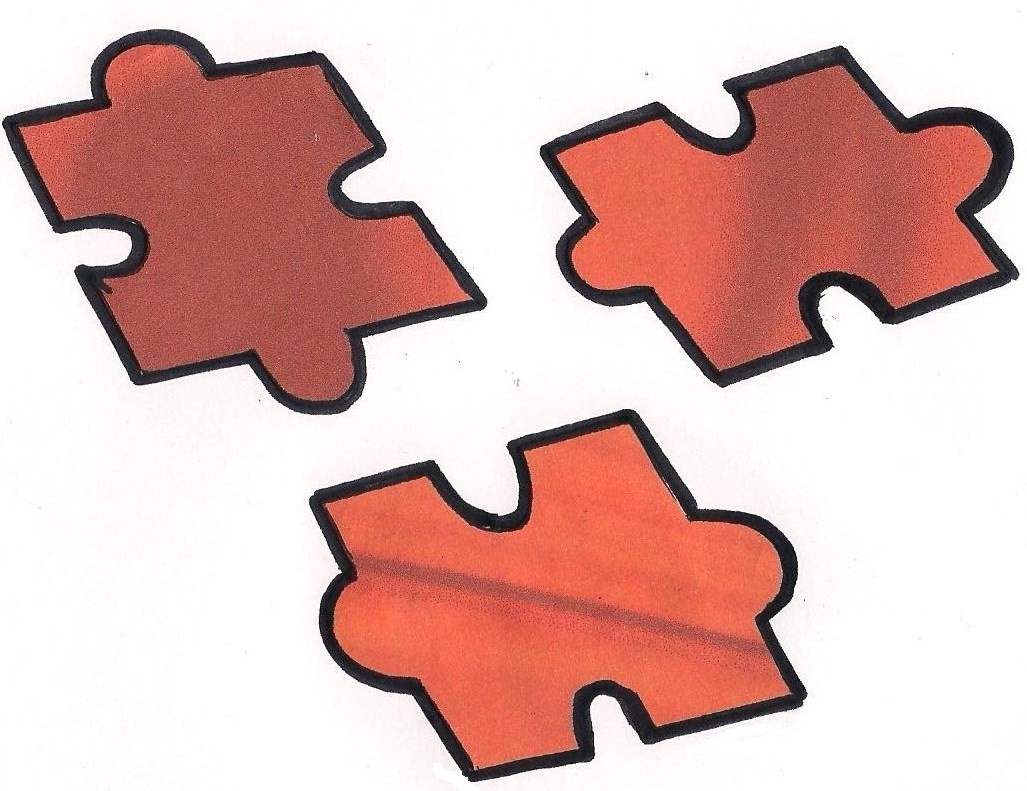
Neueste Kommentare